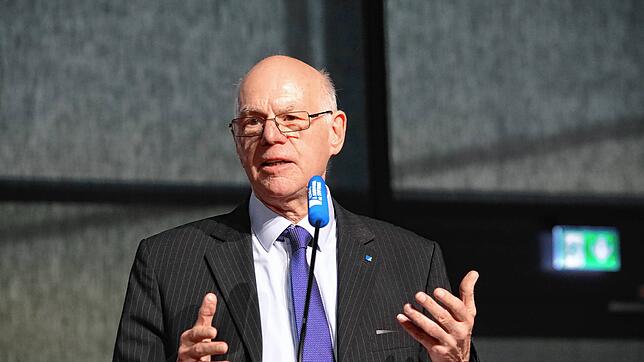Herr Lammert, der Friede in Europa ist nicht selbstverständlich, Russland führt sein drei Jahren Krieg in der Ukraine. Brauchen wir wieder eine klare politische Orientierung, was gut und was böse ist?
Norbert Lammert: Spontan will man die Vermutung bestätigen, dass diese Unterscheidung der zentrale Maßstab für Politik sein müsse. Zugleich lehrt uns die Geschichte und die eigene Lebenserfahrung, dass es nicht nur in der Politik, sondern auch im richtigen Leben komplizierter zugeht. Denn wir wissen nicht verlässlich – und schon gar nicht immer – was denn eigentlich gut und was böse ist. Die landläufige Vorstellung, das wüssten wir im Allgemeinen schon, erweist sich bereits bei der Nachfrage, wer eigentlich „wir“ ist, als brüchig.
Politikern in Deutschland wird vermehrt vorgeworfen, dass es ihnen an klaren Wertmaßstäben fehle und dass sie einseitig zu pragmatischer Realpolitik ohne ethisches Korsett tendieren. Widersprechen Sie?
Lammert: Ja – und zwar sowohl grundsätzlich als auch nach den eigenen Erfahrungen, die ich in 37 Jahren als Mitglied des Deutschen Bundestages gewonnen habe. Wir befinden uns in der glücklichen Lage, über eine Verfassung zu verfügen, die an der Wertgebundenheit und -orientierung der politischen Abläufe in unserer Gesellschaft keinen Zweifel entstehen lässt.
Jene beginnt mit dem ebenso beispiellosen wie beispielhaften Satz: „Die Würde des Menschen ist unantastbar.“ Hinter dieser Deklamation folgt dann der Satz: „Sie zu achten und zu schützen ist Aufgabe aller staatlichen Gewalt.“ Das ist nicht nur gut gemeint, sondern auch prägend für das Selbstverständnis dieses Staates geworden.
Wie drückt sich dies in der Politik aus?
Lammert: Selbst der Gesetzgeber – also der Bundestag oder die Länderparlamente – müssen sich in ihrer Legitimation für die Setzung von Normen an diesem Anspruch des Grundgesetzes messen lassen. Das kann die praktische Folge haben, dass einzelne Gesetze – auch wenn sie zweifellos demokratisch zustande gekommen sind – gegebenenfalls vom Bundesverfassungsgericht aufgehoben werden können. Und zwar dann, wenn sie mit den Grundrechten kollidieren, die als Ausdruck der Menschenwürde im Grundgesetz als unantastbar festgelegt sind.
Das Grundgesetz hat also eine Entscheidungshoheit über Gut und Böse?
Lammert: Eher über Recht und Unrecht. Das lässt sich an einem konkreten politischen Streitgegenstand verdeutlichen, dem Asylrecht. Das ist ganz sicher gut, und man möchte meinen: Je großzügiger es gehandhabt wird, desto besser sei es. Zugleich gehört zu unseren ganz handfesten praktischen Erfahrungen: Je großzügiger ein Anspruch begründet wird, desto mehr wächst auch die Inanspruchnahme – einschließlich der missbräuchlichen. So wird aus einem guten Prinzip eine beachtliche Herausforderung und im Einzelfall vielleicht auch eine schlechte Realität.
Bertolt Brecht schildert in seinem Stück „Der gute Mensch von Sezuan“ ein Dilemma: Güte gelingt nur im Wechsel mit Härte. Passt dieser Vergleich?
Lammert: Man muss gar nicht auf Brecht zurückgreifen, um die Dinge anschaulich zu machen. Wir haben nach dem Fall der Berliner Mauer und dem Kollaps der kommunistischen autoritären Systeme in Mittel- und Osteuropa an den vermeintlich unaufhaltsamen Siegeszug der Demokratie und an eine ein für alle Mal gesicherten europäischen Friedensordnung geglaubt.
Wir haben in Folge diese Erwartung Rüstungs- und Verteidigungsausgaben drastisch reduziert. Wir hatten für die bis dahin erforderlichen Mittel nicht nur gute, sondern bessere Verwendungsmöglichkeiten im Auge. Nun machen wir die schmerzliche Erfahrung, dass sich aus dem einst für gut Gehaltenen keine stabile Ordnung entwickelt hat, sondern dass das Böse in der Welt nicht nur denkbar ist, sondern stattfindet.
Was ergibt sich als praktische Antwort?
Lammert: Ich halte es da mit dem bekannten Soziologen Max Weber, der einmal gesagt hat, man müsse dem Bösen widerstehen, notfalls auch mit Gewalt, denn sonst sei man für sein Überhandnehmen verantwortlich.
Sind wir mit Blick auf die NS-Herrschaft als Deutsche in einer besonderen Pflicht?
Lammert: Ich bin der Überzeugung, dass aus der ganz besonderen deutschen Geschichte sich mindestens eine besondere Sensibilität für das Thema ergeben sollte. Denn niemals hat anderswo die diabolische Verselbständigung des Bösen in der Politik in einer ähnlichen Weise solche schrecklichen Wirkungen erzeugt wie in den zwölf Jahren des nationalsozialistischen Regimes.
Ein Nachbarbegriff des Bösen ist die Macht. Sie gilt oft als suspekt, wird andererseits aber auch eingefordert, etwa als „Machtwort“ oder „Durchregieren“. Sind dann Wertmaßstäbe gefragt?
Lammert: Macht als solche ist weder gut noch böse. Oder umgekehrt: Macht kann gut, kann aber auch böse sein. Deshalb gehört es zu den zentralen Errungenschaften der westlichen Zivilisation, dass wir auf rechtlichen Voraussetzungen bestehen: Erstens muss Macht legitimiert sein und zweitens muss sie kontrolliert sein. Und sie darf – Stichwort Gewaltenteilung – nie an einer Stelle konzentriert sein. Weder bei einer Person noch bei einer einzelnen Institution.

Wer dächte da jetzt nicht an den amerikanischen Präsidenten Donald Trump...
Lammert: Dass mindestens ein Amerikaner im Augenblick viel falsch macht, halte ich für offensichtlich. Dass die Amerikaner auf deutsche Hinweise oder Empfehlungen warten, halte ich für weniger offensichtlich. Aber dass wir gegenwärtig in der ältesten verfassten Demokratie auf diesem Globus einen erschreckenden Erosionsprozess dieser stolzen fast 250-jährigen Demokratie erleben, das gehört zu den ernüchternden Erfahrungen der Gegenwart.
Die Konrad-Adenauer-Stiftung, deren Vorsitzender Sie sind, hält auf ihrer Internetseite zahlreiche Zitate des ersten Kanzlers bereit. Er sprach einmal davon, dass auch Rücksichtlosigkeit zur Politik gehöre. Wie sollte man das verstehen?
Lammert: Nach unserem Verständnis von Demokratie ist legitime Macht daran gebunden, dass sich jede verbindliche Entscheidung auf Mehrheiten zurückführen lassen muss. Aber politische Führung ist offensichtlich mehr als das Einsammeln vorhandener Mehrheiten. Gerade bei besonders herausfordernden Themen geht es um das Erarbeiten von Mehrheiten.
Da Sie Adenauer zitiert haben: Es gibt eine legendäre Anekdote, die Anfang der 50er-Jahre im Kontext einer möglichen Aufnahme der Bundesrepublik in die Nato entstand. Adenauer schwebte der Aufbau einer Armee vor, und sein Sprecher Felix von Eckhardt sagte ihm, dafür gäbe es in Deutschland keine Mehrheit. Adenauer entgegnete, dann sei es seine Aufgabe, diese Mehrheit herzustellen.
Es brauchte also den Mut, die Bundesrepublik gegen eine Mehrheitsmeinung in der Bevölkerung auf den richtigen Weg zu bringen?
Lammert: So ist es. Ein aktuelles Beispiel: Gesellschaftliche Prioritäten ändern sich im Laufe der Zeit. Diese Änderungen entsprechen nicht immer objektivierbaren Dringlichkeiten. Dass etwa der Klimaschutz inzwischen deutlich an Resonanz verloren hat, ändert an der Dringlichkeit des Thema nicht das Geringste. Hier zeigt sich, dass Politik an Einsichten festhalten muss, auch wenn andere – zweifellos legitime – Aufgaben in der Zwischenzeit für wichtiger und vermeintlich dringlicher gehalten werden.
Da sehe ich eine Spitze gegen Friedrich Merz, in dessen Regierungserklärung der Klimawandel vermisst wurde...
Lammert: Nein, es gibt da auch noch andere Beispiele, wie etwa den Nato-Doppelbeschluss. Es gab auch für diesen keine erkennbare Mehrheit in der Bevölkerung. Tausende Demonstranten hielten die geplante Nachrüstung geradezu für die Konkretisierung des Bösen. Heute sehen Historiker darin eine der Voraussetzungen dafür, dass am Ende die Mauer fiel und in der Folge die autoritären Regime in Mittel- und Osteuropa.
Die Wehrpflicht wurde vor der Aussetzung lange kritisiert, heute ruft man wieder nach ihr. Welche Lösung sehen Sie?
Lammert: Wenn nach inzwischen allgemeiner Einsicht innere und äußere Sicherheit eine zentrale Aufgabe des Staates sind, dann wird es nicht reichen, mehr Geld für die Verteidigung bereitzustellen. Denn was nützt eine bessere Ausrüstung der Bundeswehr, wenn die Soldaten fehlen, die damit umgehen können? Das zu ändern wird mit einem freiwilligen Wehrdienst nur schwer zu erreichen sein. Die Wiederherstellung der ausgesetzten Wehrpflicht wäre zwar mit einfacher Mehrheit möglich, das aber stößt sich an der weit verbreiteten Erwartung, dass eine gesetzlich Verpflichtung ausschließlich junger Männer aus einer alten Welt stammt.
Und eine Mehrheit für eine Grundgesetzänderung, die auch Frauen einbindet, ist kaum zu bekommen...
Lammert: Deshalb ist eine soziale Dienstpflicht sinnvoll, bei der die Art des Dienstes frei gewählt werden kann. Der Wehrdienst wäre dann nur eine von vielen denkbaren Verwendungen.