Das Kultusministerium Baden-Württembergs ist überzeugt: Schulen sind keine Hotspots und Lehrkräfte haben kein erhöhtes Risiko sich mit Corona zu infizieren. Das betont Sprecherin Christine Sattler auf Anfrage des SÜDKURIER. Ministerin Susanne Eisenmann hatte sich für eine Schulöffnung nach den Weihnachtsferien am 11. Januar stark gemacht und dabei ergänzt, die „Zahlen“ ließen das zu. Doch welche Zahlen sind das?
Inzwischen ist die Landesregierung zwar zurückgerudert, die Schulen sollen nun doch bis Ende Januar zu bleiben, vorher mit Materialien und Fernunterricht überbrückt werden. Dennoch lohnt ein Blick auf die bisherige Studienlage zur Infektionsgefahr in Schulen.
Auf Nachfrage, welche Zahlen Eisenmann meinte, bleibt das Ministerium allgemein. Fachleute des Ministeriums hätten „anhand Zahlen und Datenanalysen wiederholt dargelegt, dass Schulen keine Hotspots sind und Lehrkräfte kein erhöhtes Risiko haben“, betont sie. Vielmehr werde das Virus hauptsächlich von außen in die Schulen getragen.
Studie zur Ansteckung von Kindern
Tatsächlich hatte die Landesregierung während der ersten Welle eine Studie in Auftrag gegeben, an der die Universitätskliniken Freiburg, Heidelberg, Tübingen und Ulm beteiligt waren. Doch die Studie hat nicht etwa das Infektionsrisiko in Schulen untersucht, also beispielsweise, wie viele Lehrer sich unter welchen Umständen angesteckt haben – Unterricht mit oder ohne Maske etwa, geteilte oder vollzählige Klassen. Stattdessen untersuchten die Unikliniken je etwa 2500 Eltern und Kinder bis zehn Jahre im Zeitraum vom 22. April bis 15. Mai mittels PCR-Tests.
Nur bei einem Kind und dem zugehörigen Elternteil wurde eine aktive Infektion festgestellt. Bei 64 Teilnehmern wurden Antikörper festgestellt. Bei den Kindern zwischen ein und sechs Jahren waren das 0,6 Prozent, bei den Kindern von sechs bis zehn Jahren waren es 0,9 Prozent. Bei den Eltern waren 1,8 Prozent betroffen. Die Schlussfolgerung: Kinder seien keine „Infektionstreiber“, sie steckten sich seltener an als ihre Eltern.
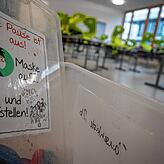
Darauf deutet auch eine bereits laufende Studie aus Österreich hin, mit der der Mikrobiologe Michael Wagner von der Universität Wien beauftragt wurde. Er untersucht im Schuljahr 2020/21, welches Infektionsrisiko in Schulen besteht. Er sagt: „Wenn das Infektionsgeschehen draußen hoch ist, kann ich eine Schule nicht so schützen, dass dort keine Übertragungen stattfinden.“
Widersprüchliche Erkenntnisse
In einem Interview betonte der Wiener Wissenschaftler allerdings auch: „Das seit Langem verwendete Narrativ, wonach Kinder unter zehn Jahren viel seltener infiziert sind, können wir für Österreich an den Schulen nicht bestätigen.“
Dagegen beruft sich das baden-württembergische Kultusministerium neben der eigenen auch auf andere Studien, die das Gegenteil nahelegen. Unter anderem habe eine bundesweite Datenanalyse von mehr als 110.000 Kindern und Jugendlichen an mehr als 100 Kinderkliniken ergeben, dass „Kinder bis zehn oder zwölf Jahren seltener mit dem Coronavirus infiziert sind“.
Der Studie zufolge wurden Mitte November nur durchschnittlich 0,53 Prozent der Minderjährigen positiv getestet. Die Stichprobe umfasste demnach Kinder zwischen 0 und 18 Jahren mit möglichen Symptomen sowie Verdachtsfälle aufgrund von Covid-19 in der Familie, überwiegend aber Patienten ohne Symptome. Doch auch hier fehlt der Schulkontext, die direkte Korrelation von Lehrern und Schülern.

Dennoch zieht die Studie die Schlussfolgerung, es gebe „keine eindeutige Evidenz für häufige Übertragungen im Schulbereich“. Demnach „scheinen“ auch Lehrer keinem erhöhten Infektionsrisiko in den Schulklassen ausgesetzt. Die vorsichtige Formulierung nutzte die Studie wohl auch deshalb, weil sie sich gar nicht mit Lehrern auseinandersetzte.
Dafür nimmt die Studie Bezug auf andere Untersuchungen etwa in Schweden und den Niederlanden, die die These stützten.
Britische Studie stützt Schulschließungen
Eine britische Studie legt dagegen nahe, dass die Infektionszahlen unter Schülern immer dann steigen, wenn die Schulen geöffnet sind. Doch eine klare Empfehlung macht die Studie nicht: Es gebe nicht genug Daten, um den Effekt von Schulschließungen auf die Gesellschaft genauer beziffern zu können.
Die Studie gibt zwar an, dass eine höhere Zahl von Schülern von 13 bis 17 Jahren infiziert wurde als bei Grundschülern, allerdings überschneide sich die Marge der Schätzungen, so dass man dazu eigentlich keine eindeutige Aussage treffen könne. Kurzum: Es ist nicht unwahrscheinlich, dass auch unter den Grundschülern ähnlich viele Kinder infiziert sind.
Ohnehin könnten die erhobenen Zahlen in Schulen nur bedingt Aufschluss geben, geben die Autoren der Studie zu bedenken. Denn: Sie gehen von Schülern aus, die weiter zur Schule gehen – also keine Symptome haben. Die Zahlen der Studie sagen also nur aus, wie viele Infektionen ohne Symptome es bei Kindern in der Schule gegeben hat, nicht aber, wie viele sich insgesamt mit dem Virus angesteckt haben.
Hinzu komme, dass sich kaum unterscheiden lasse, ob sich jemand in der Schule oder außerhalb der Schule im Kontakt mit Mitschülern oder Freunden angesteckt habe. „Derzeit ist es nicht möglich, das Ausmaß der Ansteckung in Schulen zu bestimmen“, heißt es darin weiter.
Kultusminister haben eigene Studie in Auftrag gegeben
Nun soll eine eigene Studie „in einer Gesamtschau belastbare Zahlen“ liefern, wie die Sprecherin des Ministeriums hinzufügte. Die Studie der Konferenz der Kultusminister soll vorhandene Daten „validieren“. Die Studie wurde Mitte Dezember in Auftrag gegeben, betraut sind das Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung unter der Leitung von Gérard Krause sowie die Kinderklinik der Uniklinik Köln unter der Leitung von Jörg Dötsch. Im Ergebnis soll eine Entscheidungsgrundlage entstehen, wie mit den Schulen während der Pandemie zu verfahren sei.
Warum die Studie nicht schon viel früher in Auftrag gegeben wurde, ist unklar. Auch wird die Studie den Angaben des Ministeriums zufolge keine neuen Daten erheben, sondern bereits veröffentlichte Studien zugrunde legen und „Länderdaten zur Bewertung des Infektionsverlaufs“ analysieren, sagt die Sprecherin weiter.
Koordinatorin spricht von vielen Unklarheiten
Berit Lange ist Koordinatorin des Projekts. Die Epidemiologin und Ärztin am Helmholtz-Institut sagt dem SÜDKURIER, die Anfrage sei tatsächlich „etwas spät“ gekommen. „Entscheidend ist aus meiner Sicht das regionale Monitoring der Infektionssituation in Schulen, so dass klar ist, wie das aktuelle regionale Infektionsrisiko in den Schulen wirklich aussieht“, betont die 38-Jährige. So ließen sich dann auch regionale Maßnahmen besser bestimmen.
Umso wichtiger sei es nun, Daten auszuwerten und ein Verfahren zu entwickeln, wie sowohl für das Coronavirus als auch für mögliche künftige Viruserkrankungen eine Art Überwachungssystem für Schulen entwickelt werden kann, um solche Krankheiten schnell zu erkennen und Schulschließungen künftig so kurz wie möglich zu halten, sagt die 38-Jährige. Dies sei auch deshalb wichtig, weil es für Kinder bislang ja keine Pläne gibt, sie zu impfen.
Und: „Das Infektionsrisiko an Schulen ist sehr unterschiedlich, je nachdem, welche Region wir uns anschauen.“ Mit den Daten aus dem vergangenen Jahr ließe sich besser analysieren, wie sich die Infektionszahlen bei Schülern und Lehrern entwickelt haben und in welchem Verhältnis sie zur Infektionslage und zu bereits getroffenen Maßnahmen insgesamt stünden.
Infektionsdynamik ausschlaggebend
„Das Entscheidendste ist die Infektionsdynamik drum herum“, betont Lange. Wenn die Zahl der Neuinfektionen rund um eine Schule steige, sei dies auch in der Schule der Fall. „Die Frage ist nur, in welchem Verhältnis.“ Auch, inwieweit sich diese Dynamik bremsen ließe, hinge davon ab, welche Maßnahmen in der Schule getroffen würden. Dazu gehörten neben dem Mundnasenschutz, Abstand und regelmäßigem Lüften auch präventive Tests. Doch auch hier dürfte es an entsprechenden Daten fehlen.
Lange hält es für wichtig, auch die mit der Schule zusammenhängenden Faktoren genauer zu untersuchen, etwa, wie die Kinder zur Schule kommen – etwa mit dem Bus und wie sie darin verteilt sind. Daraus könnten weitere Maßnahmen abgeleitet werden, hofft die Wissenschaftlerin. Bis Ende Januar will das Projekt ein Konzept entwerfen, wie ein solches Monitoring aussehen könnte. Die Studie selbst ist für neun Monate angelegt.
Schulschließungen wirken nur im Verbund
Wie lange die aktuelle Schulschließung dauere, hänge davon ab, wie schnell das Infektionsrisiko generell sinke. Lange macht klar: „Wenn Schulschließungen möglichst kurz ausfallen sollten, sollten auch alle anderen Maßnahmen zur Eindämmung so effektiv wie möglich gestaltet werden.“
Das ist ihrer Einschätzung nach im Bereich der Wirtschaft nicht der Fall. Dieser werde „weitgehend ausgespart“. So bleibt es seitens des Landes bei der Bitte, Homeoffice zu ermöglichen. Lange fürchtet, dass sich die aktuellen Maßnahmen wie auch die Schulschließungen deutlich länger nötig sein könnten.







