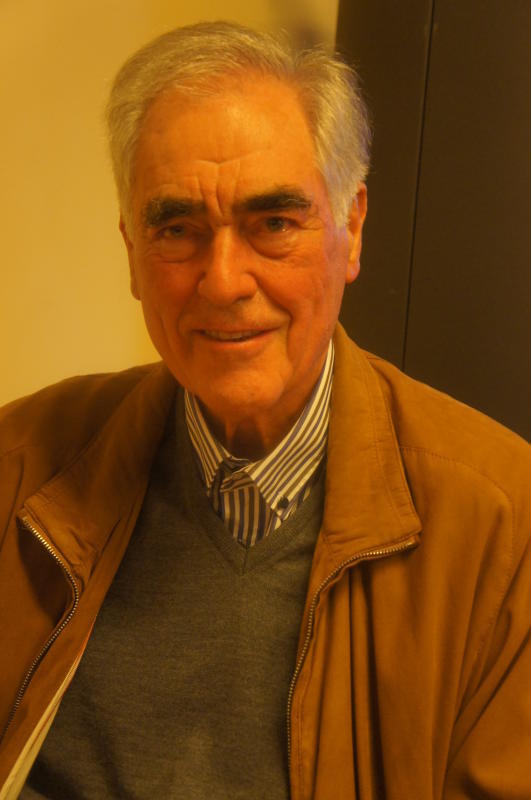"So war's frieher – davon haben vier Hödinger Urgesteine "vezellet": Zu einer spannenden Erzählstunde, in der man die berühmte Stecknadel hätte fallen hören können, hatte die Dorfgemeinschaft Hödingen mit dem Förderverein im Rahmen des Dorfjubiläums 775 Jahre ins Hofcafé Vogler eingeladen. Hundert Zuhörer aus dem Dorf und auch von auswärts im proppenvollen Raum waren interessiert, was Bruno Vogler mit seinem chronischen Abriss einer schwierigen Zeit aus seiner Kindheit im Krieg und danach zu erzählen hatte. Anton Keßler präsentierte Zahlen, Daten, Fakten eines Dorfes, Johann Schappeler und Ursula Siegel trugen ihre Erinnerungen und Geschichten vor – alle vier spannend.
Es gab viel Beifall. Niemand im Raum hatte sein Kommen bereut. Alle wollten "mol losse, was die vezellet", wie die Hödingerin Veronika Schuler und ihr Mann Johann sagten. Die Hödinger schätzen ihr Dorfleben, denn jeder kennt jeden.
"Hödingen ist für mich Heimat", betonte Ursula Rutz (früher Thomer) als gebürtige Hödingerin, die jetzt in Singen wohnt nach ihrem "Wohn-Ausflug" in Frankreich um Bordeaux und in Ungarn um Pécs. In den 50er und 60er-Jahren gab's in Hödingen mit damals rund 300 Einwohnern "vor jedem Hus noch en Mischthufe", heute ist diese Duftnote aus der damaligen Selbstversorger-Landwirtschaft verschwunden. Heute klagen die rund 750 Hödinger über fehlende Busverbindung, sind aber froh über die "mobilen Märkte" – ein Mal je Woche kommen so Backwaren, Wurst und andere Lebensmittel ins Dorf.
Maria Margarita war die richtige Moderatorin für Dialekt und Brauchtum an diesem Abend: Sie schwätzt Hödinger Alemannisch, babbelt Kurpfälzisch-Mannemerisch und kann – entgegen bekanntem Slogan – außerdem Hochdeutsch. Sie stellte die Geschichtenerzähler vor.
Die NS- und die Kriegszeit, aber auch die Besatzungszeit nach dem Krieg gingen an den Kindern damals nicht spurlos vorüber – im Zusammenleben in der Familie zu Hause, mit den Gleichaltrigen in der Schule, aber auch im damals noch stark von Kirche und Religion geprägten Tages- und Jahresablauf. Auch oder gerade in der Einfachheit des Lebens waren die Menschen aber glücklich, nicht "hinterefier", falsch rum gewickelt. Die Hödinger sind stolz auf Ihren Ort – selbstbewusst, "allefenzig" (eigenwillig) auch heute noch.
Damals und heute
- Geschichte: Eine Urkunde fürs Kloster Salem aus dem Jahr 1242 über Lehensäcker, davon drei in „Hedingen“, setzte den Zeit-Maßstab für das „Dorfjubiläum 2017 – 775 Jahre Hödingen“. Verwaltungs- und Gerichtsrechte wechselten, acht große Lehnshöfe gab es in Hödingen um 1500 bis ins Jahr 1803, als Hödingen zu Baden kam. Das Dorf an der Straße vom Hegau nach Überlingen warf die Frage auf: Gehört es zum Hegau oder zum Linzgau? Die kirchliche Zugehörigkeit hilft zur Lösung: Goldbach unterhalb von Hödingen gehörte zum Dekanat Stockach (Hegau), Hödingen mit seiner seit 1343 kleinen Bartholomäuskapelle zur Mutterkirche Aufkirch und somit zum Linzgau.
Ein Wunder 1661 – ein erblindeter Hödinger sei durch inständiges Beten sehend geworden – brachte die Marienwallfahrt in Hödingen zum Blühen, führte 1685 zum Neubau der Kirche mit der Baupflicht des Spitals Konstanz sowie Hand- und Spanndiensten der Region für das Marienheiligtum. 100 Jahre später wurde Hödingen Kaplaneipfründe mit einem Pfarrkurat. Hödingen löste sich kirchlich langsam von Überlingen, und die Pfarrei St. Bartholomäus gehört heute mit Bonndorf St. Pelagius, Nesselwangen St. Peter und Paul sowie Sipplingen St. Martin zur Seelsorgeeinheit Sipplingen, die von Pfarrer József Biró geleitet wird.
- Gegenwart: Im Dorf oberhalb der Kernstadt Überlingen leben heute etwa 750 Einwohner, 286 Hektar umfasst die Gemarkungsfläche. Seit Mitte 1974 ist Hödingen einer der sieben Überlinger Stadtteile. Martin Keßler ist Ortsvorsteher und Vorsitzender des Ortschaftsrats, in dem Werner Niedermann und Hede Gesine Elsing seine zwei Stellvertreter sind. Dazu kommen Matthias Auer, Thomas Gegg, Clemens Mayer, Markus Schappeler, Herbert Schmon und Clemens Vogler als Ortschaftsräte. Etliche Vereine gibt es in Hödingen: Turn- und Sportverein (TuS), Musikverein, Sportverein, Feuerwehr, Narrengesellschaft Kilbegoschter, Kirchenchor Hödingen-Nesselwangen, Förderverein Dorfgemeinschaft Hödingen, Katholische Landjugend (KLJB) und Landfrauen, Verein zur Erhaltung der Kulturlandschaft Hödingen. Bettina Reich ist Rektorin der Grundschule Hödingen.
(fw)
Prägende Kriegsjahre
Bruno Vogler, zu dessen Familie fünf Kinder gehören, war in Hödingen von 1969 bis 1974 Bürgermeister. Mit der Eingliederung in die Stadt Überlingen am 1. Juli 1974 übernahm er für weitere 25 Jahre (1974 bis 1999) als Ortsvorsteher den Vorsitz im Ortschaftsrat. Er führte als studierter Ingenieur für Landbau seinen Hof in Hödingen, zusammen mit seiner heute bereits verstorbenen Frau Helene und seiner Familie. Bis in kleinste Einzelheiten beschrieb er auf 13 eng bedruckten Seiten das Leben der Menschen im Dorf während des Krieges, vor allem am Ende – vom religiös-kirchlichen Leben mit dem Verbot für den Lehrer, die Orgel zu spielen, und für den Dienst der Ministranten während der Unterrichtszeit sowie von der Ablieferung zweier Glocken für Kriegszwecke. Bomber flogen in Richtung Rüstungsbetriebe Friedrichshafen. Er berichtete von der Stollenanlage und dem Außenlager des KZ Dachau in Aufkirch und der unmenschlichen Behandlung der Zwangsarbeiter, von den Evakuierten mit etwa 170 Fremden im Ort Anfang 1945, vom "Dorf voller Soldaten" und der "Panzersperre als Belastung", von der "Erlösung und Entspannung", als mit den weißen Fahnen kein Schuss beim Einmarsch der Franzosen fiel. Er schilderte das erst nur zögerlich zugelassene politische Leben, das Sammeln von Lebensmitteln 1945 – "ein Jahr voller Ängste, recht- und machtlos ausgeliefert." 1946 kehrten die Kriegsgefangenen zurück. Hödingen musste 18 Gefallene und sechs Vermisste registrieren. Erfreulich: An seiner Erstkommunion 1946 gab's für Bruno Vogler die erste Tafel Schokolade, und im November 1946 waren die Hödinger zu den ersten freien Kommunalwahlen aufgerufen.
Lateinische Gebete als Ministrant
Anton Keßler, 83 Jahre alt, teilt mit Johann Schappeler Geburtsjahr und Geburtstag. Zu seiner Familie mit seiner Frau Friedel gehören eine Tochter und zwei Söhne, einer davon der jetzige Ortsvorsteher Martin Keßler. Der leidenschaftliche Rutengeher war gleich in zwei Berufen tätig: Als Forstwirt in der markgräflich-badischen Verwaltung mit Arbeit vor allem in deren Waldbesitz zwischen Hödingen und Owingen bis Herdwangen. Dazu betrieb er eine Landwirtschaft im Nebenberuf. Er schilderte die Situation der Landwirtschaft 1945 und danach: Schon damals hörten kleinere Betriebe auf, andere wurden größer. Beim Hüten kannte man jeden Baum. Und dann die lateinischen Gebete als Ministrant: "Ad deum qui laetificat iuventutem meam" – oft setzte es Ohrfeigen, wenn man's nicht konnte. Um 7.15 Uhr war jeden Tag Messe. Keßler "vezellte" von der Wasserversorgung – zuerst mit Tiefbrunnen, dann kam der Leitungsbau mit Frondiensten und schließlich der Anschluss an die Bodensee-Wasserversorgung (BWV). Er stellte die Linde auf dem Hödinger Berg vor, die Drei Linden als Ort der Gerichtsbarkeit der Fürstenberger und Nellenburger, die Hügelgräber und die Marieneiche im Haslen.
Immer für Streiche zu haben
Johann Schappeler ist auch "Hedinger Urgestein". Wie die anderen Landwirte betrieb er mit seiner Familie, zu der fünf Töchter und ein Sohn gehören, eine "Allround"-Landwirtschaft – Vieh, Getreide, Kartoffel, Obst mit Brennerei. Auch er war in einem weiteren Beruf tätig: 25 Jahre beim Vermessungsamt Überlingen. Als Vierjähriger kam er "uf Spätzge in Kindergarte: Die hon i radebutz it kenne verbutze", sagte er über seine Erzieherin. Die Klassen 1 bis 4 waren die Nachmittags-, die Klassen 5 bis 8 die Morgenschüler. Für Streiche waren sie immer zu haben – immer "e Mordskomede sin dië gsi" – und sie seien dummerwies ruskomme" – wie der unbrauchbar gemachte Glockenschlägel. Später seien sie "e weng riëbiger worre", die Aufmerksamkeit der "halbstarken Männer" galt jetzt immer mehr dem anderen Geschlecht. Die Landwirtschaft bestimmte Leben und Dialekt-Vokabular: "S'Ross hot d'r Homwäeg besser g'funde als d'r Bur." Nach dem Krieg musste man fast hungern, der Schwarzhandel blühte, das Geld war wertlos. Es ging um "Reche, Bole, worbe und Birling mache, s'Heu ablade von Hand, Mähe mit dem Haberg'schirr, Herdepfel, Fütterrübe und Dreschmaschi".
Einfache, aber schöne Kindheit
Ursula Siegel, Urhödingerin, kam im letzten Kriegsjahr 1945 in die Schule. Nach den damals üblichen acht Schuljahren in der Volksschule Hödingen machte sie in Überlingen eine Lehre zur selbstständigen Schneiderin mit Meisterprüfung und eröffnete in Hödingen ihr Schneidergeschäft. Sie ist nicht "uf Stör gange", sie hat also nicht bei ihren Kunden geschneidert. Diese sind zu ihr ins Haus gekommen. "Unsere Kindheit isch scho oafach gsi: Im Dorf rumrenne, Leit ärgere, Schlitte fahre im Winter, sibbe Lehrer in acht Johr, en usrangierter Tornischter als Schualranze." Aber "us allene isch ebbes worre!" Das Hochdeutch der "Usbomde un Flichtling" war für die Hödinger Schüler "wie Englisch oder Französisch uf omol." Kaufladen und Handwerker, die im Winter "uf Stör gange" sind, gehörten zum Dorf, auch der Schuamacher" – alles in om Raum, Wohn-, Schlafzimmer un Werkstatt". Ursula Siegel wundert sich: " Es isch scho komisch – do isch alles im Unterdorf gsi. Im Gegensatz zu heute: Sogar s'Narrebommloch hot me versetze messe, dass der Narrebomm jetz au no im Oberdorf stoht!" Streng war die Prozedur, "wend Wieber große Wäsch ket hond, do hosch messe uss de Fiass go." Es gab vor der "Verstädterung" andere "Stroßenämme." Und nach der kirchlichen Trauung "hot mer de Reichtum vu de Buredochter-Braut kenne aluege – die Käschte sind alle off g'stande und waret voll bis obe na." Andere fielen auf: Der Rossknecht "am Sundigmorge nebe om i de Kirch – do hot mer scho g'schmeckt, wo der schaffet und schloft", oder "de Krauthobler" im Herbst – "igstampfet's Kraut" in jeder Woche "us de Krautstande." Und heute "wisset viele numme, was se esse wend".