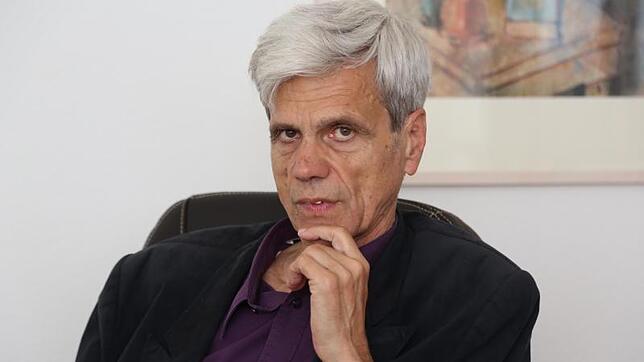Der Landtagsabgeordnete der AfD, Wolfgang Gedeon, fordert vom Singener Oberbürgermeister Bernd Häussler und den Stadträten die Beendigung der Stolperstein-Aktion. Gleichzeitig ruft er in einem als offenen Brief titulierten Schreiben die Singener Bevölkerung dazu auf, sich der Verlegung der Gedenksteine zu widersetzen. In dem Schreiben bezeichnet der Politiker insbesondere die für Dienstag vorgesehene Verlegung eines Stolpersteins für Ernst Thälmann als problematisch. Der Vorsitzende der Kommunistischen Partei Deutschland (KPD) und Reichstagsabgeordnete Ernst Thälmann wurde 1933 von den Nationalsozialisten verhaftet und 1944 im Konzentrationslager Buchenwald ermordet.
Wolfgang Gedeon hält die Art des Gedenkens mittels Stolpersteinen prinzipiell für fragwürdig. Ihn stört, dass "täglich Hunderte von Menschen über Steine mit Opfernamen trampeln, ohne auch nur im entferntesten daran zu denken, um wen oder um was es hier geht". Es gebe angemessenere Arten des Gedenkens im Rahmen von Gedenkstätten, von denen es in Deutschland genügend gebe. Die Stolperstein-Initiatoren würden zudem ihren Mitmenschen eine bestimmte Erinnerungs-Kultur aufzwingen und ihnen vorschreiben, wie sie wann wessen zu gedenken hätten. "Wer gibt diesen oft sehr penetranten Moralisten das Recht dazu?", fragt Wolfgang Gedeon, "es geht nicht nur um eine Inflationierung von Gedenken, sondern auch darum, dass hier aus Erinnerungs-Kultur immer mehr Erinnerungs-Diktatur wird."
In der Verlegung eines Stolpersteins für Ernst Thälmann wird nach Ansicht von Wolfgang Gedeon nun eine "Galionsfigur der DDR aufs Gedenkpodium" gehoben und er verweist darauf, dass Ernst Thälmann bis zu seiner Verhaftung 1933 Vorsitzender der kommunistischen Partei und glühender Stalinist gewesen sei. Ernst Thälmann habe einen kommunistischen Umsturz geplant und eine rote Diktatur in Deutschland errichten wollen, wie sie später in der DDR verwirklicht worden sei. "Es ist kein Zufall", schreibt Wolfgang Gedeon, "dass Thälmanns Verwandte hohe Positionen in diesem DDR-Staat innehatten – ein Staat, der Tausende von Menschen auf dem Gewissen hat." Mit der Gedenkaktion verhöhnten die Initiatoren nicht nur die Opfer der roten Diktatur, "sondern tragen dazu bei, die Bundesrepublik Deutschland in eine neue Groß-DDR zu verwandeln".

Frage des Umgangs mit Geschichte
Zu einer grundsätzlich anderen Bewertung der Stolpersteine kommt Oberbürgermeister Bernd Häussler. Wie er auf Anfrage des SÜDKURIER mitteilt, soll damit zur Reflexion, aber auch zur Diskussion angeregt werden. Ernst Thälmann sei durch seinen Erschießungstod 1944 in KZ Buchenwald zweifellos ein Opfer des nationalsozialistischen Gewaltregimes gewesen, womit die Grundbedingung der Würdigung durch einen Stolperstein erfüllt sei.
OB Häusler ist sich dabei durchaus bewusst, dass Ernst Thälmanns politisches Wirken nicht auf die Errichtung eines demokratischen Deutschlands in heutigen Sinne gerichtet war und er dürfe als prominenter Wegbereiter einer Diktatur nach damaligen sowjetisch-stalinistischen Vorbild angesehen werden. Allerdings muss nicht jeder Stolperstein zwangsläufig auch als Huldigung verstanden werden. Im Fall von Ernst Thälmann werde daran erinnert, "dass es auch von den Launen geschichtlicher Entwicklungen oder Ereignisse abhängig ist, ob nachfolgende Generationen bei der Würdigung des gesamten Lebenswerkes eines Menschen diesen letztlich als Täter oder als Opfer betrachten müssen".
Das Schreiben von Wolfgang Gedeon zeige dagegen, dass es dem AfD-Politiker eben nicht um die kritische Auseinandersetzung um eine in der Tat sehr komplexe Persönlichkeit gehe. "Er nimmt die Stolpersteinverlegung lediglich zum Anlass, eine ihm und seiner Gedankenwelt missliebige Erinnerungskultur anzuprangern. Alle bisher der Öffentlichkeit zugänglichen Äußerungen von Herrn Gedeon zeichnen das Bild eines Mannes, dem das Wachhalten der Erinnerung an die für die Deutschen und ihre Nachbarvölker leidvolle Zeit des Nationalsozialismus unliebsam zu sein scheint."
Steine fürs Bewusstsein
Der Verlegung von Stolpersteinen gehen umfassende Vorarbeiten von örtlichen Initiativen voraus. In Singen wurden auf diesem Weg bisher die Schicksale von rund 70 Menschen recherchiert, die Opfer des Nationalsozialismus wurden. Am Dienstag, 20. Februar, werden sieben weitere Stolpersteine verlegt, drei von ihnen erinnern an die Familie Thälmann. Irma Vester, Tochter von Rosa und Ernst Thälmann, wohnte bis 15. August 1944 in der Rielasinger Straße 180, wo auch die Mutter während einiger Monate lebte. Mit der Verlegung eines Stolpersteins für den Vater Ernst soll zugleich an das Schicksal der Familie erinnert werden. Außerdem kommt man damit einem Wunsch des Künstlers und Stolperstein-Initiators Gunter Demnig nach, der die Verlegung selbst vornehmen wird. Die Verlegung der drei Steine beginnt um 14 Uhr. (tol)