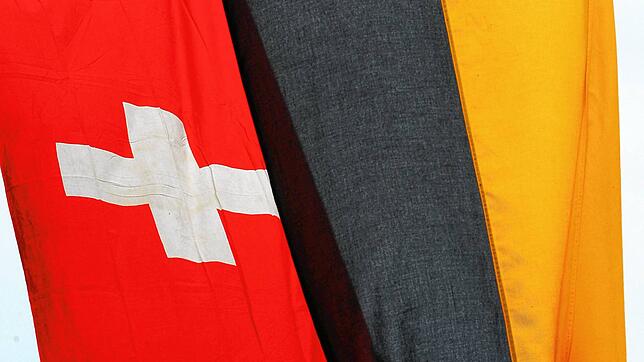Nachbarschaft birgt Konflikte. Was jeder weiß, der mit den Bewohnern von nebenan jemals über absurde Zaunhöhen, laute Musik und Grillwürstchenrauch gestritten hat. Nicht anders ist es da im Standortentscheid für das Schweizer Atomendlager an der deutschen Grenze. Denn so behäbig sich der Widerstand bei den Schweizern zeigt, so argwöhnisch betrachten ihn die Menschen aus Deutschland.
Streit um Schatten des Kühlturms in Leibstadt
Allerdings – und das vorneweg – ist es nicht der erste Konflikt zwischen beiden Ländern. Und nicht der erste zwischen den benachbarten Regionen. Der Fluglärm ist sicherlich ein Zwist, der diesen Raum seit Dekaden beschäftigt. Und auch die atomaren Belange haben hier eine gewisse Vorgeschichte. Die geht in etwa so:

Vor vielen Jahren, Mitte der 80er, ging das Kernkraftwerk Leibstadt in Betrieb. Nur wenige Meter weiter, auf deutscher Seite, formierte sich Protest – gegen den Kühlturm. Die Dampffahne, so hieß es damals, werfe einen Schatten auf die Gemeinde Dogern. Der Bürgermeister wollte sogar vor Gericht.
Zum Prozess aber kam es nie, stattdessen einigte man sich außergerichtlich auf eine Spende: 500.000 Deutsche Mark zahlten die AKW-Betreiber für Dogern, Albbruck und Waldshut-Tiengen.
Jahrzehnte später ein nächstes Problem, das atomare Tiefenlager. Einfach hinnehmen wollen die deutschen Kommunen das Risiko nicht. „Wir sind bereit, die Lasten mitzutragen. Aber die Auswirkungen eines Lagers machen an der Staatsgrenze nicht halt“, erklärte Martin Kistler, der Landrat von Waldshut, bei einer Medienkonferenz am Montag im Schweizer Stadel.
Abgeltungen sind freiwillige Zahlungen
„Unsere Gemeinden tragen einen substanziellen Teil zur Lösung der Schweizer Aufgabe bei.“ Die Kommunen erwarten Unterstützung. Denselben Status wie die betroffenen Kantone der Schweiz. Nicht nur, was die Mitsprache bei den künftigen Planungen betrifft, sondern auch eine entsprechende Abgeltung. Freiwillige Zahlungen der Kernkraftwerkbetreiber und des Bundes also.
Man wolle fair und gleichberechtigt behandelt werden, verlangte Kistler. „Der Prozess kann nur dann gelingen, wenn das Projekt beidseits des Rheins auf Anerkennung stößt.“

Ähnlich äußerte sich Thekla Walker (Grüne). Die betroffene Bevölkerung in Baden-Württemberg, sagte die Umweltministerin des Landes, leiste einen großen Beitrag zur Endlagerung des schweizerischen Atommülls. Dies müsse sich bei Abgeltungsverhandlungen niederschlagen.
Für Rita Schwarzelühr-Sutter haben die Sicherheit des Standorts und mögliche Auswirkungen auf die Menschen, die Umwelt und die Trinkwasservorkommen Priorität. Erst dann könne es tatsächlich zu einer Genehmigung für das Atomendlager kommen, findet die SPD-Bundestagsabgeordnete aus dem Wahlkreis Waldshut. „Parallel dazu sollte über die Entschädigungen bereits gesprochen werden.“ Bei diesem Jahrtausendprojekt müsse die deutsche Seite genauso beteiligt werden.
Schwarzelühr-Sutter fordert einen Staatsvertrag
Die Politikerin fordert einen Staatsvertrag. Am Ende, so bekräftigt sie, müsse es „glasklare Regeln“ geben – was Kompensationsmittel angeht, aber auch die Frage, was bei Unfällen mit radioaktivem Material geschieht. Mit einer Festschreibung würde dies dauerhaft und verbindlich geregelt.
Grundsätzlich ist die Schweiz gewillt, die belasteten Regionen mit „Ausgleichszahlungen für die regionale Entwicklung“ zu entschädigen. Schon 2017 hat das Nachbarland einen Leitfaden dafür erarbeitet.
Demzufolge sollen deutsche Gemeinden in der Verhandlungsdelegation der Gemeinden beteiligt werden, berichtet das Bundesamt für die Sicherheit der nuklearen Entsorgung. Die deutsche Seite verlangt aber noch mehr, die Beteiligung des Landes Baden-Württemberg in der Delegation der Standortkantone.
Wer am Ende wie viel Geld erhalten wird, steht indes noch nicht fest. Höhe und Kriterien seien Gegenstand von Verhandlungen, sagte Roman Mayer vom Bundesamt für Energie. Die Schweiz bereitet sich gerade darauf vor.
Verhandelt werden könne frühestens ab 2024, dann sollte das Rahmenbewilligungsgesuch für das Lager eingereicht sein. Fest stehen dürfte laut Monika Stauffer vom Schweizer Bundesamt für Energie: „Die Abgeltungsverhandlungen werden herausfordernd sein.“
Beim Bau des Kernkraftwerks Leibstadt war das anders. Kompensationszahlungen gab es einem Sprecher zufolge nicht. Hier existiert ein Fonds, der immer wieder auf fünf Jahre angesetzt ist. Gemeinden im direkten Umfeld bekommen dadurch regelmäßig Beträge, die in soziale oder kulturelle Zwecke fließen sollen. Gebaut wird damit dann zum Beispiel ein Spielplatz – mit dem Hinweis der freundlichen Unterstützung durch das Kernkraftwerk.
Schweigegeld, wie auch heute noch einige in Dogern finden. Das stimme aber nicht, betont Hauptamtsleiter Markus Böhler. „Wir pflegen eine gute Zusammenarbeit mit dem Kernkraftwerk.“ Es gehöre zur Region, auch als Arbeitgeber. Langfristig belastet hat es die nachbarschaftlichen Beziehungen zur Schweiz jedenfalls nicht.