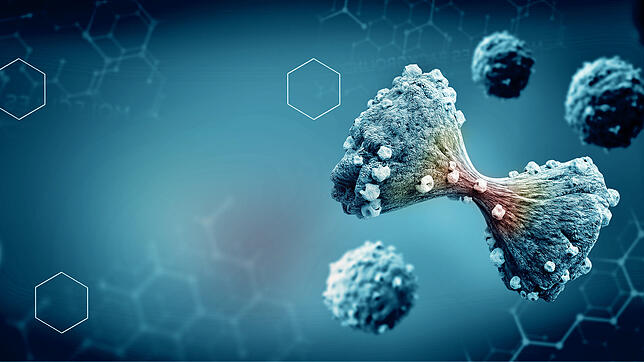Frau Weg-Remers, die Europäische Union hat dem Krebs den Kampf angesagt und möchte die Krankheit komplett ausrotten. Ist das überhaupt möglich?
Krebs ist eine Krankheit, die viele Menschen betrifft. Pro Jahr erkranken in Deutschland etwa 500 000 Erwachsene. Statistisch gesehen, ist jeder Zweite im Laufe des Lebens betroffen. Krebs ist ein Sammelbegriff für über 200 Tumorformen, die sich in ihren biologischen Eigenschaften stark unterscheiden können. Man kann daher nicht damit rechnen, dass es ein Medikament geben wird, das bei allen Krebsarten hilft.
Welche Meilensteine wurden in den letzten 20 Jahren in der Krebsforschung gewonnen?
Neu ist, dass die konventionellen Säulen der Therapie wie Operation, Chemo- und Strahlentherapie, nicht mehr die einzigen Möglichkeiten sind, Krebs zu behandeln. Durch die moderne Krebsforschung sind zwei neue Säulen hinzugekommen, die meist ergänzend eingesetzt werden.
Was sind das für Säulen?
Zum einen handelt es sich um die „zielgerichteten Therapien“. Das sind Medikamente, die bestimmte Eigenschaften der Tumorzellen ansprechen. Das ist eine völlig neue Herangehensweise. Sie werden meist bei Patienten mit fortgeschrittenen Krebserkrankungen eingesetzt und ermöglichen ein längeres Überleben. Zum Teil werden sie aber auch verwendet, um bei Patienten mit örtlich begrenzter Krebserkrankung die Heilungschancen zu verbessern.
Wie wirken diese Medikamente im Körper?
Es gibt mehrere unterschiedliche Wirkprinzipien. Die Wirkstoffe können etwa die Signalübertragung der Krebszellen hemmen und damit das Tumorwachstum und die Metastasierung bremsen. Sie werden häufig nur dann eingesetzt, wenn auf den Tumorzellen des Patienten bestimmte Merkmale nachgewiesen wurden, die von den zielgerichteten Wirkstoffen angesteuert werden.
Und die zweite Säule?
Tumorzellen entwickeln sich aus unseren eigenen Körperzellen. Sie werden deshalb nicht als „fremd“ erkannt und vom körpereigenen Immunsystem bekämpft. Die neuen Immuntherapien können das Immunsystem aktivieren, um gegen die Tumorzellen vorzugehen.
Hat sich auch bei der Chemo- und Strahlentherapie etwas getan?
Auch diese Therapien haben sich deutlich verbessert. Darüber hinaus haben wir heute wirksame Untersuchungsmethoden, um bestimmte, häufige Krebsarten frühzeitig zu erkennen. Über alle Krebsarten hinweg haben wir heute eine 50 prozentige Heilungschance. Vor 20 Jahren konnte nur jeder Dritte geheilt werden. Dieser Effekt ist die Summe aller Fortschritte: Früherkennung, Diagnostik, konventionelle Therapie und die Einführung neuer Therapien.
Hat man eher bei Krebsarten Fortschritte gemacht, die früher schon heilbar waren, oder bei Krebsarten, die als sicheres Todesurteil galten?
Beides hat sich verbessert. Patienten mit Hodenkrebs oder Brustkrebs hatten auch früher schon gute Heilungschancen. Diese haben sich mit den Fortschritten der Medizin weiter verbessert. Aber auch bei Erkrankungen, die früher nicht heilbar waren, gibt es Fortschritte. Ein Beispiel ist der schwarze Hautkrebs. Wird er so spät erkannt, dass schon Metastasen vorliegen, war das früher ein sicheres Todesurteil. Gerade in dieser Situation können die Immuntherapien einigen Patienten sehr gut helfen. Die Betroffenen haben eine deutlich längere Lebenserwartung, falls die Immuntherapie bei ihnen anspricht. Ob man mit der Immuntherapie fortgeschrittenen schwarzen Hautkrebs dauerhaft heilen kann, können wir heute noch nicht sagen. Dafür fehlen noch langfristige Studien.
Was macht der Krebsinformationsdienst und wie sieht Ihr Arbeitsalltag aus?
Wir recherchieren wissenschaftliche Publikationen zu Krebs, um immer auf dem neuesten Stand zu sein. Dieses Wissen stellen wir per Telefon und E-Mail all denen zur Verfügung, die Fragen zu Krebs haben. Die Beantwortung übernehmen qualifizierte Ärzte. Im Jahr beantworten wir durchschnittlich 34 000 Anfragen aus ganz Deutschland, überwiegend von Krebspatienten und Angehörigen.
Bekommen Krebspatienten also eine ärztliche Zweitmeinung?
Nein, aber wir können darüber informieren, welche Behandlungsmöglichkeiten es in einer bestimmten Erkrankungssituation gibt. Mit diesem neu gewonnen Wissen können die Patienten besser mit ihrem behandelnden Arzt über Behandlungsalternativen sprechen. Wir schauen uns auch die individuellen Befunde eines Patienten genau an. Auf der Basis von wissenschaftlichen Erkenntnissen kann man Aussagen darüber machen, welchen Nutzen und welche Risiken oder Nebenwirkungen eine Therapiemethode für den Patienten voraussichtlich haben kann.
Der Krebsinformationsdienst setzt sich mit Anrufern individuell auseinander. Wie viel kostet eine Beratung?
Unsere Beratungen sind grundsätzlich kostenlos. Genau wie das Deutsche Krebsforschungszentrum werden auch wir größtenteils durch das Bundesministerium für Bildung und Forschung finanziert. Unsere Informationen sind deshalb neutral, unabhängig und nicht interessengeleitet.
Wie gehen Sie mit den Menschen um, die aufgelöst bei Ihnen anrufen und was raten sie ihnen?
Wir raten den Patienten und Angehörigen am Telefon zunächst einmal, tief Luft holen und den ersten Schock zu verdauen. Krebs ist in der Regel keine Notfalldiagnose. Anschließend sollten sich Betroffene über ihre Krankheit informieren und sich auf das nächste Arztgespräch vorbereiten. Zu diesem Gespräch kann man auch einen Fragenkatalog mitbringen, den man sich vorher notiert hat, denn im Gespräch kann es schnell passieren, dass man wichtige Fragen vergisst. Wenn möglich, kann man auch einen Angehörigen oder Freund zum Gespräch mitnehmen. Wenn die ersten Untersuchungsergebnisse da sind, kann man um Kopien bitten, die man in einer eigenen Patientenmappe ablegt. Oft sind mehrere Spezialisten in die Behandlung involviert. Mit einer Patientenmappe ist sichergestellt, dass alle auf dem aktuellen Stand bleiben. Wichtig ist zudem, dass man sich einen Arzt des Vertrauens, möglichst in der Nähe, sucht. Er behält den Überblick.
Auch Angehörige leiden, wenn ein Freund oder Familienmitglied Krebs hat. Wie sollen diese Menschen bestmöglich mit der Situation umgehen?
Angehörige sind häufig sehr betroffen und möchten gerne helfen. Häufig sind sie aber unsicher, wie sie mit der Situation umgehen sollen und wie der Alltag neu geordnet werden kann. Wichtig ist deshalb: Mit eigenen Ressourcen haushalten und bei Bedarf Unterstützung suchen. Ob man seine eigenen Sorgen mit dem Patienten teilen sollte, ist vom Einzelfall abhängig. Wenn man helfen möchte, aber nicht so recht weiß wie, empfehlen wir im Zweifel: Mit dem Patienten reden und fragen, was er braucht.
Zur Person
Susanne Weg-Remers leitet den Krebsinformationsdienst im Deutschen Krebsforschungszentrum in Heidelberg. Nach dem Medizinstudium und der Promotion arbeitete sie zunächst einige Jahre als Ärztin in der Inneren Medizin und wechselte dann in die biomedizinische Forschung. Seit 2007 ist sie am Deutschen Krebsforschungszentrum tätig. Hier leitete sie zunächst die Stabsstelle Strategie und Programme und übernahm 2012 die Leitung des Krebsinformationsdienstes. Er wird vom Bundesministerium für Bildung und Forschung gefördert. Das Landesministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst ist beteiligt. Der Krebsinformationsdienst ist unter der Telefonnummer 0800 420 30 40 oder per Mail unter krebsinformationsdienst@dkfz.de erreichbar. (sku)