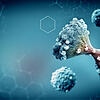Robin Benkelmann ist ungern Überbringer schlechter Nachrichten. Aber auch das gehört bei seinem Beruf als Onkologe zum Tagesgeschäft. Besonders dramatische Schicksale belasten auch ihn, wie er selbst zugibt: "Mit solchen Schicksalen umzugehen gelingt meistens – aber nicht immer."
Diagnosen nicht mit nach Hause nehmen
Für den Arzt, der am Klinikum und einer Facharztpraxis in Konstanz arbeitet, ist es eine große Herausforderung, die schweren Schicksale der Patienten nicht mit nach Hause zu nehmen. "Wer das zu nah an sich heranlässt kann daran zerbrechen", sagt er. Um das zu verhindern und das Erlebte zu verarbeiten, spricht er mit seiner Ehefrau über Sorgen und Ängste. "Für mich ist das Gespräch ein ganz wichtiger Baustein, aber jeder geht damit anders um."
Privates wirkt nebensächlich
Ein weiteres großes Problem ist, private und berufliche Angelegenheiten richtig einzuordnen. "Manchmal ist man mit dem Kopf noch im Krankenhaus und bei seinen Patienten. Das sollte aber eigentlich nicht ständig passieren", so der 44-Jährige. Egal ob schlechte Noten in der Schule oder eine kaputte Spülmaschine – Alltagsprobleme im Privaten können im Vergleich zu tödlichen Krebsdiagnosen manchmal unbedeutsam wirken. Dann müsse man sich selbst zwingen, richtig einzuordnen: "Am Wochenende ist Auszeit und da sind Sorgen und Probleme der Familie genauso wichtig, wie die Bekämpfung von Krebs."
Arztausbildung hat sich verändert
Damit Menschen mit Tumorerkrankung geheilt werden, hat er eine jahrelange Ausbildung an der Universität in Gießen durchlaufen. Doch der Studiengang von damals unterscheidet sich teilweise stark von den Inhalten von heute. Vor 15 Jahren wurde beispielsweise nicht viel Wert darauf gelegt, Ärzte für ihre Patienten zu sensibilisieren. Heute ist das laut Benkelmann anders. In Seminaren und Schulungen wird darauf aufmerksam gemacht.
Wenn Ärzte schon Probleme damit haben, schockierende Diagnosen wegzustecken, muss es für Patienten wohl besonders dramatisch sein
. Deshalb benötigen genau dann Ärzte besonderes Fingerspitzengefühl, wie Benkelmann findet: "Die wenigsten können das von Anfang an. Patienten mit negativen Diagnosen zu konfrontieren kann man aber lernen."
Junge Ärzte haben es schwer
Dafür wird jungen Ärzten das sogenannte Spikes-Protokoll an die Hand gegeben. Es ist eine Checkliste, die vorgibt, wie bei einem kritischen Patientengespräch vorgegangen werden sollte. Das Verfahren umfasst unter anderem: Zeit nehmen und eine freundliche, räumliche Atmosphäre schaffen sowie herausfinden, wie gut der Patient über die Krankheit bereits informiert ist – eigentlich Dinge, die selbstverständlich sein sollten, aber in der Praxis laut Benkelmann nicht immer umgesetzt wurden.
Offene Fragen sind ein Problem
Fatal sei es, wenn ein Patient mit offenen Fragen und ohne ein konkretes Konzept von einem Arzt nach Hause geschickt wird. Dieser Plan wird beim Onkologen Robin Benkelmann immer in einem Gespräch, gemeinsam mit dem Patienten und Angehörigen, ausgearbeitet: "Sie müssen nach einem Aufklärungsgespräch das Gefühl haben, umfassend über die Art, den natürlichen Verlauf und die therapeutischen Optionen ihrer Erkrankung informiert zu sein." Nur dann könne man mit einer entsetzlichen Diagnose leben.