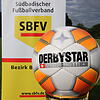Herr Hitzlsperger, nervt Sie manchmal die Verantwortung, die Sie tragen?
Nein, warum?
Sie werden verantwortlich gemacht für den sportlichen Erfolg des VfB Stuttgart, haben ein Millionenbudget zu verantworten und dann spricht man dem Fußball ja auch eine gesellschaftliche Verantwortung zu. Das könnte einem doch auch mal zu viel werden.
Ich würde nicht sagen, das nervt. Natürlich ist es manchmal anstrengend, aber ich habe es mir selbst ausgesucht. Ich hatte eine Wahl. Das ist ein großes Privileg: wählen zu können.
Haben Sie im Oktober 2019 geahnt, was auf Sie als Vorstandsvorsitzender zukommt?
Ich hatte ungefähr eine Idee. Ich kenne die Stadt, den Verein, die gesamte VfB-Familie. Ich habe mich bewusst dazu entschieden, weil ich das Bestreben hatte, Dinge zu verändern. Weil ich ehrgeizig bin und erfolgreich sein will und sicher war, dass ich einiges nur verändern kann, wenn ich Vorsitzender im Vorstand bin. Diese Rolle bringt mit sich, dass man in der ersten Reihe steht. Man hinterlässt also etwas. Und wenn etwas nicht funktioniert, bekommt man die geballte Ladung Frust ab. Beides habe ich gespürt.
Sie waren zu großen Teilen erfolgreich – und wollen trotzdem im kommenden Jahr aufhören. Denken Sie nicht manchmal: Mensch, die Früchte würde ich doch noch ganz gerne selbst ernten?
Wir konnten zwischenzeitlich schon ernten, aber es soll für den VfB noch mehr geben. Bis zum letzten Tag werde ich hier mein Bestes geben. Davon profitiert der VfB und davon werde auch ich profitieren. Aufzuhören, war meine Entscheidung. Ich werde immer Sympathie für diesen Klub haben, auch wenn es mal schwierige Momente gab. Mir war stets bewusst, dass der VfB ein hoch emotionaler Verein ist.
Hat der Fußball an sich eigentlich eine gesellschaftliche Verantwortung?
Den Fußball an sich gibt es meines Erachtens genauso wenig wie die Medien.
Dann lassen Sie uns erst mal über den VfB Stuttgart reden.
Wir haben schon vor vielen Jahren begriffen, dass wir mehr Verantwortung tragen, als die, unsere Fans zu begeistern mit guten Spielen. Wir bieten mit dem Spiel etwas Tolles, eine andere Welt als den Alltag, eine Gemeinschaft – das ist die emotionale Seite. Wir leben davon, dass Menschen ins Stadion gehen, eine Bratwurst kaufen und ein Trikot – das ist die geschäftliche Seite. Mittlerweile aber ist es so, dass die Leute auch sagen: Ich will stolz auf meinen Verein sein. Sie wollen wissen, wie wir mit Diversität umgehen, ob wir uns um Inklusion kümmern und wie wir zum Klimaschutz stehen. Das ist die gesellschaftliche Seite. Aber wir müssen stets abwägen, was wir leisten können – und was nicht.
Kann diese Verantwortung auch mal zur Last werden?
Ja, weil wir manchmal Menschen enttäuschen müssen. Dann muss man sagen: Es tut uns leid, das können wir nicht mehr leisten. Vielleicht, weil wir schlicht als Fußballverein das Personal nicht haben und uns entschieden haben, das verfügbare Geld in den Sport zu investieren. Vielleicht aber auch, weil wir bestimmte Botschaften nicht vermitteln wollen als Club oder weil wir feststellen, dass es Themen gibt, bei denen wir gar nicht die Glaubwürdigkeit haben, um uns öffentlich zu positionieren. Beim VfB sagen wir: Gesellschaftliches Engagement, Nachhaltigkeit, das ist ein wichtiger Teil von uns und da nehmen wir unsere Rolle als Botschafter auch an.
Dass Sie mit Öffentlichkeit kein Problem haben, haben Sie spätestens mit Ihrem Coming Out bewiesen. Nun werden Sie oft zu den Themen Gleichberechtigung und Diversität befragt. Stört Sie das?
Im Gegenteil. Das war mir bewusst und ich freue mich, dass ich diese Rolle einnehmen kann. Wenn es nicht sichtbar ist, dass ein Profifußballer schwul ist, dann glauben viele Menschen, dass das nicht zusammengeht. Dass schwule Männer nicht leistungsfähig genug sind für den Profisport. Damit wollte ich aufräumen. Und dann wollte ich einen Beitrag leisten, dass wir Bewegung reinbekommen in die ganze Diskussion.
Kürzlich hat Philipp Lahm schwulen Spielern abgeraten, sich zu outen.
Da möchte ich dagegen steuern, indem ich berichte, was mir seit meinem Coming Out widerfahren ist – das sind fast ausschließlich positive Erfahrungen. Ich möchte anderen zeigen, dass das Leben hervorragend weitergehen kann. Was mir nämlich häufiger passiert, ist, dass Menschen die traurige Geschichte von mir hören wollen. Nach dem Motto: Das muss ja ganz schlimm gewesen sein. Da sage ich: Stopp!
Spricht aus Ihrer Sicht also nichts gegen ein Coming Out als aktiver Fußballer?
Man muss verstehen, wie die Realität von Fußballern aussieht. Die wichtigsten Bezugspersonen sind die Mannschaftskollegen, das Trainerteam und das private Umfeld, sie will man nicht enttäuschen. Wer den Schritt in die Öffentlichkeit wagt, wird eine Reaktion auslösen. Tags drauf wäre die Presse am Trainingsplatz. Das kann die Mannschaft beflügeln, aber auch negativ beeinflussen. Der Spieler will nicht derjenige sein, der die Stimmung im Team negativ beeinflusst, weil er plötzlich im Rampenlicht steht. Die betroffenen Spieler müssen ein gutes Gespür dafür haben, ob sie vom engsten Umfeld getragen werden. Und da sind wir wieder bei der Verantwortung. Man hat ja auch eine Verantwortung für die Gruppe, für den Verein. Aber das Gequatsche, man könne das als Spieler nicht riskieren, weil die Fans oder Sponsoren negativ reagieren könnten: Das ist nicht mehr zeitgemäß. Die Fans sind viel weiter.