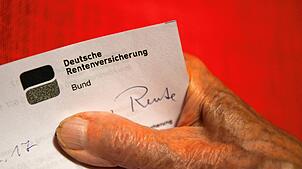Herr Rasch, wie muss ein gutes Bier schmecken?
Rasch: Ich mag besonders Pilsbiere. Das ist für einen gebürtigen Südbadener vielleicht nicht ganz typisch, aber Biere, die die süddeutsche Süße und die norddeutsche Herbe in sich vereinen, schmecken mir einfach am besten. Insofern bin ich bei Rothaus richtig, denn das ist auch die Charakteristik unseres Tannenzäpfle. Das Bittere des Hopfens sollte nicht zu stark in den Vordergrund rücken. Die Süffigkeit muss auf dem Gaumen schon deutlich erkennbar sein.
Geschmack ist individuell, Qualität universell. Was macht ein gutes Bier aus?
Krieger: Die Handwerkskunst ist das eine, die Rohstoffe das andere. Bei Rothaus ist es Tradition, nur mit Hopfen und Gersten- oder Weizenmalz von regionalen Erzeugern zu arbeiten. Das Wasser kommt sowieso von unseren Quellen direkt hinter der Brauerei. Unsere Heimatverbundenheit hat dabei nicht nur mit der Qualität der Rohstoffe zu tun. Vielmehr ist für mich unstrittig, dass die Region geschmacklich eine eigene Charakteristik entfaltet. Das ist beim Bier nicht anders als beim Wein. Den Boden, das Klima, das schmeckt man einfach. Wir kennen auch unsere Lieferanten persönlich und gehen regelmäßig auf den Acker, um die Braugerste oder den Hopfen anzuschauen.
Der Rotwein aus dem Bordeaux schmeckt jedes Jahr anders, weil das Wetter jedes Jahr unterschiedlich ist. In Baden ist das Wetter auch immer anders. Warum schmeckt Rothaus dann jedes Jahr gleich?
Rasch: Bier ist geschmacklich nie gleich. Die Kunst besteht darin, die unterschiedlichen Charakteristika der Rohstoffe so hervorzuheben oder abzuschwächen, dass das Endprodukt immer klar als Rothaus erkennbar ist. Das kann man beispielsweise über Variation von Temperaturen und Zeiten beim Maischen oder Gären beeinflussen. Denn wir wollen und brauchen jedes Jahr den gleichen Geschmack im Glas.
Krieger: Wir haben zwar gut ausgewogene und über viele Jahre ausgefeilte Rezepturen, variieren diese aber regelmäßig in Abhängigkeit der unterschiedlichen Beschaffenheit der Rohstoffe. Die Grenzen definiert für uns das deutsche Reinheitsgebot.
Rothaus im Schwarzwald
Die Rothaus-Brauerei ist nach Eichbaum in Mannheim Baden-Württembergs zweitgrößte Brauerei und erwirtschaftete 2016 einen Umsatz von 75,6 Millionen Euro. Der Gewinn vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen (EBITDA) betrug 29,8 Millionen Euro. Rothaus hat rund 240 Mitarbeiter. Weil das Unternehmen aber fast alle Aufträge regional vergibt, beschäftigt die Staatsbrauerei indirekt rund 1000 Menschen in der Region. (wro)
Deutschland geht die Braugerste aus. Immer mehr Bauern bauen statt Korn Mais oder Raps an. Können Sie Ihre regionale Rohstoffversorgung noch sichern?
Rasch: Wir können das noch, weil wir mit unseren Bauern und Mälzereien seit Jahren, wenn nicht Jahrzehnten zusammenarbeiten. Wir zahlen für die Gerste und das Braumalz auch mehr als den Marktpreis. Es gibt Großbrauereien, die sich ausschließlich auf dem Weltmarkt bedienen und immer dann einkaufen, wenn die Rohstoffe günstig sind. Wir kaufen jedes Jahr zur gleichen Zeit ähnliche Mengen. Nur so funktioniert der regionale Kreislauf.
Kleines Bierlexikon
Wie in ganz Deutschland steigt auch in Baden-Württemberg trotz sinkendem Bierabsatz die Anzahl der Braustätten leicht an. Besonders Hausbrauereien sorgen für diesen Zuwachs. Ein Überblick:
-
PilsDas hopfig-herbe Bier nach Pilsener Brauart ist mit Abstand das beliebteste Bier in Baden-Württemberg, in manchen Regionen hat es über 50 Prozent Marktanteil. Pils ist untergärig: Es wird bei niedrigen Temperaturen gebraut und die Hefe sinkt bei der Gärung ab. Pils hat meist rund 4,8 Prozent Alkoholgehalt.
-
WeizenWeizen- oder Weißbiere – beide Namen bezeichnen meist dasselbe – sind ein Beispiel dafür, wie stark sich der Biermarkt verändern kann. „Früher hatte Weizenbier nur zwei Prozent Marktanteil in Baden-Württemberg, heute sind es bis zu 20 Prozent“, sagt Matthias Schürer, der Vorsitzende des baden-württembergischen Brauerbundes. Mindestens die Hälfte des zum Brauen verwendeten Malzes muss aus Weizen sein. Weizenbier ist im Gegensatz zum Pils obergärig und hat meist um die 5,4 Prozent Alkoholgehalt.
-
ExportDas Export bildet mit dem Hellen und dem Märzen eine Familie ähnlicher Biere, die sich nur in Details unterscheiden. Die Export-Verbreitung ist in Baden-Württemberg sehr unterschiedlich, Hochburgen sind Karlsruhe und vor allem Mannheim. Am Bodensee hat es nur kleinere Marktanteile. Export hat meist etwas mehr Alkohol als Pils und ist im Geschmack süßlicher. Dank seiner Brauart ist es länger haltbar als andere Biere. Es konnte deswegen schon früher in andere Regionen exportiert werden – so kam das Export zu seinem Namen.
-
Helles„Ganz klar hier angekommen ist die gesteigerte Nachfrage nach Hell-Bier, das früher nur in Bayern verbreitet war“, sagt Matthias Schürer mit Blick auf Baden-Württemberg. Große Unterschiede zum Export herauszuarbeiten ist schwer. Meist enthält Helles etwas weniger Alkohol.
-
MärzenDas Märzen hat meist einen etwas höheren Alkoholgehalt als Export, ist meist etwas dunkler und deutlich malziger.
-
Kellerbier, ZwicklUnter diesen Namen werden oft Biere verkauft, die nicht gefiltert werden und deswegen naturtrüb sind.
-
Craft-BierUnter diesem Begriff lassen sich neue, teils sehr ungewöhnliche Biersorten kategorisieren, die nicht den bisherigen Geschmacksmustern entsprechen. Eine klare Definition von Craft-Bier gibt es allerdings nicht. Aus dem Englischen übersetzt bezeichnet der Begriff lediglich ein Bier, das handwerklich hergestellt wird. Matthias Schürer sagt jedoch: „Wenn man unter Craft-Bier einfach handwerklich gebrautes Bier versteht, dann sind in Baden-Württemberg eigentlich alle Brauereien Craft-Bier-Brauereien.“ (dod)
Ist es auszuschließen, dass künftig einfach keine Bauern mehr da sein werden, die Gerste anbauen?
Rasch: Die bäuerlichen Erzeugerstrukturen zu erhalten, ist eine der größten Herausforderungen für die Zukunft. Wir freuen uns daher, dass in der Landwirtschaft vermehrt über ökologische Themen wie Fruchtfolge auf den Äckern diskutiert wird. Da ergibt der Gerstenanbau für die Bauern nämlich wieder Sinn. Dennoch wird es für regional verwurzelte Brauereien, von denen es in Baden-Württemberg zum Glück noch einige gibt, nicht einfacher.
Der Pro-Kopf-Verbrauch von Bier geht unaufhaltsam zurück. Warum schmeckt das Getränk immer weniger Menschen?
Rasch: Das Bier schmeckt den Menschen nach wie vor. Der Konsum geht vor allem deswegen zurück, weil die Gesellschaft und mit ihr die Biertrinker altern. Und im Alter trinkt man nicht mehr so viel wie in der Jugend. Jugendliche wiederum trinken immer noch Bier, aber eben auch zunehmend andere Getränke, die die Industrie anbietet.

Ein Kasten Rothaus ist heute nicht unter 15 Euro zu haben. Senken Sie doch den Bierpreis, dann werden auch wieder mehr Menschen zugreifen. . .
Rasch: Wir haben den Anspruch, mit den besten Rohstoffen das beste Bier zu brauen. Gleichzeitig bezahlen wir unsere Mitarbeiter ordentlich und kaufen Rohstoffe regional ein. Das alles kriegt man aber eben nicht für zehn Euro. Die Fernsehbier-Brauer, die den Kasten im Supermarkt zu zehn Euro oder weniger verschleudern, interessiert das nicht. Da kommt das Malz eben aus der Ukraine, und da zählt nur der möglichst große Absatz. Das ist nicht unsere Welt.

Rothaus ist hochprofitabel. Ihre Renditen sind doppelt so hoch wie die von Daimler. Spielraum gäbe es also...
Rasch: Wir haben in den vergangenen Jahren viel getan, um Kosten überall dort einzusparen, wo es auf das Produkt keine Auswirkungen hat. Vor gut zehn Jahren waren wir mit die Ersten, die sich mit einer eigenen Hackschnitzelanlage unabhängiger vom Öl gemacht haben. Seither investieren wir massiv in Effizienz und Nachhaltigkeit. Wir arbeiten mit Wärmerückgewinnung und nutzen Solarthermie. Wenn Sie sich vor Augen halten, dass die Energiekosten bei Brauereien mit gut einem Viertel des Gesamtaufwands zu Buche schlagen, wissen Sie, wie das den Gewinn beeinflussen kann. Ein nicht unbedeutender Nebeneffekt ist übrigens, dass wir in den letzten drei Jahren unseren CO2-Ausstoß um 50 Prozent senken konnten. Auch weil wir für die Produktion ausschließlich Ökostrom verwenden.
Wie lief das Jahr 2017?
Rasch: Wir hatten ein gutes Jahr, in dem wir uns besser als der Markt entwickelt haben. Gegenüber unseren Wettbewerbern haben wir Marktanteile hinzugewonnen. Bei einzelnen Sorten wie beim alkoholfreien Bier haben wir sogar im zweistelligen Bereich zugelegt.

Wie sieht es mit dem Gewinn aus?
Rasch: Unsere Ertragslage ist, auch dank der Effizienzmaßnahmen, 2017 sehr gut gewesen. Wir können unsere sehr gute Rendite halten.
Trotzdem haben Sie 2017 erstmals in der Firmengeschichte Werbung für ein Bier gemacht – Ihr Weizen. Warum? Will das keiner trinken?
Rasch: Werbung war für uns bisher ein Fremdwort. Wir haben einen Marketing-Mitarbeiter im ganzen Unternehmen. Beim Pils sind wir in Baden-Württemberg seit Jahren Marktführer. Dafür sind wir auch über die Landesgrenzen hinaus bekannt. Aber unser Hefeweizen kennen einfach noch nicht genug Menschen. Daher die Marketing-Aktionen.
Hat sich das ausgezahlt?
Rasch: Ja. Während der Weizenbierkonsum landesweit um 4,4 Prozent gesunken ist, haben wir zweistellig zugelegt.
Wird man jetzt öfter Rothaus-Werbung sehen oder hören?
Rasch: Die Weizenbier-Kampagne läuft 2018 weiter. Ich kann mir gut vorstellen, dass wir auch andere Sorten bewerben.
Deutschland ist zwar das Land der Biere, aber viele Innovationen kommen aus dem Ausland. Die Craft-Bier-Welle wurde in den USA losgetreten. Wieso sind deutsche Brauer so rückständig?
Krieger: Sie sind nicht rückständig. Es gibt auch in Deutschland viele Craft-Bier-Erzeuger, und wir freuen uns über diesen Trend.
Wieso das? Das ist doch eine neue Konkurrenz für Sie. . .
Krieger: Beim Thema Preiskampf sind besonders die großen Braukonzerne aktiv, nicht die Regionalbrauereien oder Craft-Bier-Hersteller. Letztere haben es geschafft, der jungen Generation das Bier als Getränk wieder schmackhaft zu machen und bei ihnen auch Interesse für das damit verbundene Handwerk zu wecken. Da entwickelt sich die kommende Generation der bierbegeisterten Kunden und Fachkräfte.
Warum hat Rothaus denn kein eigenes Craft-Bier?
Krieger: Wir sind zu 100 Prozent ausgelastet. Eine neue Biersorte mit dem Anspruch höchster Qualität zu brauen, würde Investitionen nach sich ziehen, die sich im Fall von Craft-Bier nicht rechnen würden. Dazu kommt, dass es nicht unserem Weg entsprechen würde. Wir sind als Brauerei sehr traditionell. Wir setzen auf wenige Produkte von sehr hoher Qualität. Und wir verzetteln uns nicht.
Andere Brauer aus dem Schwarzwald setzen zum Teil seit Jahren mit Erfolg auf Craft- oder Spezialbiere. . .
Rasch: Wir sind froh um jeden, der das Thema vorantreibt, aber für uns stellt sich die Frage im Moment nicht. Wir müssen bei einem Trend nicht immer die Ersten sein, aber wir wollen erfolgreich sein. Das ist der Rothaus-Weg.
Im internationalen Brauereigeschäft bleibt kein Stein auf dem anderen. Immer mehr Brauer verschwinden. Bereitet Ihnen das Sorge?
Krieger: Wir haben hier eine ähnliche Entwicklung wie in der Lebensmittelindustrie. Es entstehen Großkonzerne, die ganze Länder oder Weltregionen dominieren. Vor einigen Jahren hätte es niemand für möglich gehalten, dass ein belgisch-brasilianischer Bierkonzern – Anheuser-Busch Inbev/SAB-Miller – den nordamerikanischen Markt zu fast drei Vierteln beherrscht und sich Bier-Ikonen wie Budweiser, Miller, Corona, Stella Artois oder Beck‘s einverleibt. Auch bedeutende Biermarken aus Asien gehören mittlerweile zu dem Unternehmen. In vielen Ländern gibt es meist nur noch ein oder zwei Konkurrenten, oft ebenfalls Weltkonzerne wie Heineken oder Carlsberg. Die Folge sind Oligopole und hohe Preise für die Verbraucher.

Deutschland, die Insel der Bier-Glückseligen?
Rasch: In Deutschland haben wir immer noch Hunderte Brauereien, die im Wettbewerb stehen und viele unterschiedliche Produkte anbieten. Zwar gewinnen auch hier die großen Brauerei-Gruppen immer mehr Einfluss, aber wer will, kann noch regional trinken. Trotzdem bekomme ich als Bier-Fan immer fast Tränen in den Augen, wenn ich mir überlege, wie viele Biermarken in den vergangenen Jahren durch Aufkauf von Großbrauereien auch hierzulande kaputtgemacht wurden.
Fragen: Walther Rosenberger
Zur Person
- Christian Rasch, geboren im Jahr 1968, ist seit Mitte 2013 Alleinvorstand der Badischen Staatsbrauerei Rothaus AG in Grafenhausen im Hochschwarzwald. Der gebürtige Lörracher ist seit Langem der erste Rothaus-Chef, der nicht aus der Politik kommt. Sein Vorgänger Gerhard Stratthaus, war Finanzminister in Baden-Württemberg sein Vor-Vorgänger, Thomas Schäuble, war Verkehrs-, Justiz- und Innenminister im Land. Rasch ist gelernter Hotelbetriebswirt und war von 1992 bis 2008 in führenden Positionen bei der Großbrauerei Radeberger tätig. Dann wechselte er als Vertriebs- und Marketingdirektor zu Stuttgarter Hofbräu. 2010 übernahm er den Chefposten bei den Stuttgarter Brauern. Die Stuttgarter Hofbräu AG gehört zu Radeberger.
- Der gebürtige Heilbronner Ralf Krieger, geboren im Jahr 1973, ist seit 2013 erster Braumeister und Betriebsleiter bei Rothaus. Der in Weihenstephan ausgebildete Brauer und Getränketechnologe ist seit 2002 bei Rothaus tätig. Als erster Brauer bei Rothaus ist es seine Aufgabe, ein ganzes Team an Braumeistern zu koordinieren – um irgendwann Eichbaum aus Mannheim den Platz als größte Brauerei in Baden-Württemberg streitig zu machen. (wro)