Der Spätherbst und Winter am Bodensee können ziemlich aufs Gemüt schlagen. Nur selten verzieht sich in dieser Jahreszeit der hartnäckige Nebel über Deutschlands größtem Binnengewässer und gibt den Blick auf die riesige Wasserfläche und die Berge im Hintergrund frei. Im Normalfall dünstet der See Feuchtigkeit aus. Wie ein riesiger Kochtopf voll Wasser auf einer Herdplatte.
Öko-Wärme aus den Tiefen des Bodensees
Bene Müller macht das nichts aus. Im Gegenteil. Der Chef des Singener Unternehmens Solarcomplex freut sich sogar über die feuchtwarmen Nebelschwaden. Für ihn eröffnen sie neue Möglichkeiten. Müllers Unternehmen ist einer der Pioniere für den Bau von Nahwärmenetzen in Baden-Württemberg.
20 Projekte hat Solarcomplex in den vergangenen zwei Jahrzehnten zwischen Schwarzwald, Alb und Bodensee realisiert. Tausende Menschen erhalten seither auf Basis nachhaltiger Rohstoffe wie Holzhackschnitzel, Solarthermie oder Biogas CO2-freie Wärme in ihre Stuben.
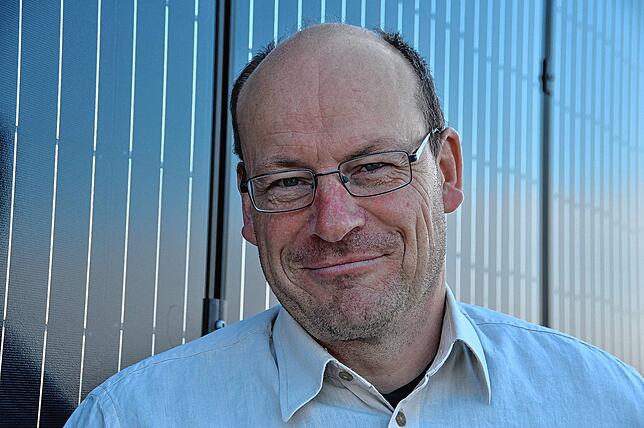
Jetzt wagt sich die Singener 80-Mitarbeiter-Firma an eine ganz neue Technologie. Solarcomplex zapft das schier unendliche Wärmepotenzial an, das im Wasser des Bodensees gebunden ist. „Die paar Tage Nebel nehme ich dafür gerne in Kauf“, sagt Müller.
Startschuss für Projekt nahe Konstanz
In den Bodenseegemeinden Wallhausen und Dingelsdorf werden Müllers Ingenieure für rund 25 Millionen Euro in den kommenden Monaten ein 16 Kilometer langes Nahwärmenetz errichten, das von einer riesigen Wärmepumpe gespeist wird, die tief in den Bodensee hineinragt.
Mehrere Hundert Haushalte in den schmucken Ufer-Gemeinden werden ihre Öl- und Gasheizungen einmotten und stattdessen nachhaltige Wärme aus dem Bodensee beziehen. „Das Ok von den Rathäusern ist da, und seit einiger Zeit ist auch klar, dass genügend Bürger mitmachen“, sagt Müller. „2025 geht‘s jetzt los!“
Rund um den Bodensee sind Kommunen, Stadtwerke und Privatfirmen derzeit in Aufbruchstimmung. Es grassiert das Wärmepumpenfieber. Die Heiztechnologie, die vielen wohl durch die kleinen grauen Kästen vor Einfamilienhäusern bekannt sein dürfte, soll nun im großen Maßstab für die Beheizung ganzer Stadtteile oder Wohnquartiere genutzt werden. Als Wärmequelle dient das Seewasser.
Schweiz ist Treiber der Technologie
Die Uferörtchen, deren Gemeinderäte beschlossen haben, den See anzuzapfen, reihen sich mittlerweile wie Perlen auf einer Kette. Entsprechende Pläne gibt es etwa in Konstanz, Meersburg, Langenargen, Bregenz und diversen Schweizer Gemeinden.
Fünf große Seenkraftwerke sollen auf Schweizer Seite errichtet werden. Treiber der neuen Technologie sind insbesondere seenahe Kantone und Stadtwerke, die die Seenwärme als Möglichkeit sehen, die heimische Energiewende voranzutreiben. Ihren Optimismus schöpfen die Beteiligten aus den guten Erfahrungen, die viele Zentralschweizer Orte seit Jahren mit entsprechenden Anlagen an ihren Alpenseen machen.
IGKB hebt Verbot auf
Am internationalen Gewässer Bodensee indes waren Seethermie-Kraftwerke über viele Jahrzehnte tabu. Bis 2014 war es verboten, Wasser zum Kühlen oder Heizen aus dem Bodensee zu entnehmen. Die mit Experten der Anrainerstaaten besetzte Internationale Gewässerschutzkommission für den Bodensee, kurz IGKB, fürchtete negative Auswirkungen auf das sensible Ökosystem.
Gestützt auf eine Vielzahl an Daten von den Schweizer Seen kippten Deutschland, Österreich und die Schweiz aber vor genau zehn Jahren das seit 1987 bestehende Nutzungsverbot für Bodenseewasser. Und seit einiger Zeit kommen nun immer mehr Projekte an den Start.

„Der Bodensee bietet beste Voraussetzungen, die umliegenden Städte und Gemeinden mit Energie zu versorgen“, sagt Alfred Johny Wüest, Professor am Wasserforschungsinstitut Eawag der Eidgenössischen Technischen Hochschule (ETH) in Zürich. Das Energiepotenzial des Sees sei riesig und durch die oft ufernahe Bebauung leicht nutzbar.
Planungen sind herausfordernd
Tatsächlich speichert der bis zu 252 Meter tiefe See enorme Mengen Wärmeenergie. Theoretisch reicht sie aus, die Hälfte des Wärmebedarfs aller elf Millionen Baden-Württemberger zu decken. Ganz ähnliche Rechnungen gibt es auf Schweizer Seite.
Was grundsätzlich möglich ist, ist aber noch lange nicht wirtschaftlich. Werden die Leitungen, durch die die Wärme mittels einer Flüssigkeit zu den Haushalten transportiert wird, zu lang, steigen die Verluste. Und irgendwann rechnet sich die Ökoenergie nicht mehr. Öl und Gas zu verheizen, wird dann günstiger.
Die aktuellen Planungen für Seenkraftwerke nehmen daher eher die direkte Umgebung im örtlichen Nahbereich ins Visier. Oder sie setzen auf Mischkonzepte. So nimmt die Stadt Konstanz bei ihren, zusammen mit dem Schweizerischen Kreuzlingen vorangetriebenen Wärmepumpen-Planungen auch die Abwärme aus einer nahen Müllverbrennungsanlage mit in den Blick.
Vorbild für diese Kombi-Planungen ist auch hier die Schweiz. In der Eidgenossenschaft will die Metropole Zürich ihre Wärmeversorgung schrittweise umkrempeln. Als Wärmequelle sollen die Abwärme einer Müllverbrennungsanlage, das Abwassernetz und warmes Grundwasser dienen. Dazu kommt dann die See-Thermie aus dem Zürichsee. „Solche Lösungen ermöglichen es, auch Metropolen mit nachhaltiger Wärme zu versorgen“, sagt ETH-Experte Wüest.

In der Schweiz trieben mittlerweile viele größere Städte solche Projekte voran, sagt der Professor, neben Zürich etwa Lugano, das westschweizerische Biel, Genf oder die Gemeinde Zug. Am ambitioniertesten plant aber Luzern. Hier sollen in einem ersten Schritt 6800 Haushalte in Vororten mit Seenwärme aus dem Vierwaldstättersee gespeist werden, perspektivisch dann die ganze Stadt.
Alternative zu Kohle und Gas
Die Schweiz ist bei dem Thema Vorreiter, weil sie historisch in Energiefragen benachteiligt war. Das Land verfügt weder über Kohle- noch Gasvorkommen. Daher machte man sich schon während des Zweiten Weltkriegs Gedanken über alternative Energiequellen.
Neben der Kernkraft und der klassischen Nutzung von Wasserkraft stieß man für den Wärmebereich auch auf die thermische Nutzung der heimischen Seen und Fließgewässer. Früh entstand daher etwa in Genf eine erste größere Anlage, die noch heute Gebäude der dort ansässigen Vereinten Nationen versorgt.

Aber auch in Deutschland nimmt das Thema jetzt Fahrt auf. Der Energiepreisschock in Folge des russischen Angriffskriegs ab Anfang 2022 hat die Planungen dies- wie jenseits des Rheins intensiviert. In Mannheim läuft seit rund einem Jahr Deutschlands größte Flusswasser-Wärmepumpe im Regelbetrieb.
In dieser Zeit habe sie es auf „deutlich mehr Betriebsstunden gebracht, als erwartet“, sagt Fabian Ahrendts, Experte für Hochtemperatur-Wärmepumpen am Bochumer Fraunhofer-Institut IEG. Der Start der 20-Megawatt-Anlage sei so gut verlaufen, dass bereits eine weitere, mit 150 Megawatt Leistung, deutlich größere Flusswärmepumpe in Planung sei. Eine gleich große Anlage soll auch in Köln ab 2027 rund 30.000 Haushalte über das Fernwärmenetz mit Wärme beliefern.
In Cottbus wiederum soll ein vollgelaufener Tagebau energetisch angezapft werden, und die Gemeinde Neustadt in Holstein will per Küsten-Wärmepumpe Ostseewasser zum Heizen nutzen. Städte wie München oder Aachen wiederum treiben die Energiewende im Heizungskeller per Tiefengeothermie voran. „Überall kommen jetzt solche Projekte“, sagt Fraunhofer-Fachmann Ahrendts.
Treiber ist der BEW-Fördertopf
Der Treiber ist ein nur in Fachkreisen bekanntes Förderprogramm, die sogenannte Bundesförderung für effiziente Wärmenetze, kurz BEW. Über das Programm können sich die Betreiber von Öko-Wärmenetzen einen Gutteil ihrer Investitionen vom Staat zurückholen und sich teilweise auch Zuschüsse zu den Betriebskosten sichern.

Außerdem verpflichtet der Bund die deutschen Kommunen seit Jahresbeginn, sich Gedanken über die Umstellung ihrer Wärmeversorgung auf regenerative Energien zu machen. Diese sogenannte kommunale Wärmeplanung sei zusammen mit dem BEW „der entscheidende Türöffner“ für die Umstellung Deutschlands auf Öko-Wärme und der Auslöser des Booms der Großwärmepumpen in Seen und Flüssen, sagt Fraunhofer-Fachmann Ahrendts.
Die Kosten der Projekte sind sehr hoch
Wie nachhaltig der Boom ist, hängt aber nicht zuletzt von den politischen Weichenstellungen ab. Die Gelder aus dem BEW fließen zunächst nur bis Ende 2026. Ob der Fördertopf dann wieder gefüllt wird, hängt maßgeblich von der Energiepolitik der neuen Bundesregierung ab.
Und Förderung brauchen die Projekte. „Die Errichtung von Großwärmepumpen und Wärmenetzen ist sehr kapitalintensiv“, sagt Ahrendts. Kommunen und Stadtwerke allein seien damit finanziell überfordert. Die privaten Investoren und Energieversorger, die sich derzeit in den Markt vorwagten, bräuchten jetzt langfristige Sicherheiten, um den Projekten die Stange zu halten.
Solarcomplex-Chef Bene Müller vom Bodensee sieht das ähnlich. Allerdings erkennt er, dass der Umstieg auf alternative Heizkonzepte immer attraktiver wird. Denn die schon heute bestehenden Gesetze sähen für Nutzer klassischer Öl- und Gasheizungen erhebliche Zusatzinvestitionen vor, wie er sagt.
Haushalte sparen Geld beim Heizen
Viele Öl- und Gasheizungsbesitzer in den Gemeinden Wallhausen und Dingelsdorf scheint er überzeugt zu haben – mit einer gänzlich nachhaltigen Heiztechnologie und jährlichen Einsparungen von mehreren Hundert Euro, die beim Anschluss an den Bodensee als Wärmelieferanten winken.






