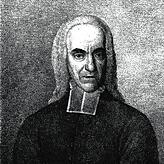Gerade wie zwei Kerzen stehen die beiden Schwestern vor mir. Zwei Chefinnen von ungewöhnlichem Zuschnitt, beide in der traditionellen Tracht der Diakonissen: graues langes Kleid, schwarzer schmaler Schurz. Hoch aufgeschossen Schwester Magdalene – breit im Leben stehend Schwester Lore. Die beiden evangelischen Frauen bilden so etwas wie den Vorposten des schwäbischen Pietismus im badischen Villingen. Sie leiten das Haus Tannenhöhe am westlichen Rand der Stadt.
Vielen jagt bereits das P-Wort eine wohlige Gänsehaut über den Rücken. Es gibt viele Witze über Pietisten und Pietistinnen. Die meisten davon sind schlecht oder witzlos. Herbert Wehner, der ehemalige Zuchtmeister der SPD, nannte die württembergischen Frommen „Pietkong“, und das war nicht nett gemeint.

Wer vor der Tannenhöhe in Villingen parkt und sich anmeldet, lässt etwaige Vorurteile am Besten im Handschuhfach zurück. Die nach vorne gerichtete Frage lautet: Wie geht eine derart eingeschworene Gemeinschaft mit der Pandemie um? Wie leben und überleben die 49 Schwestern in Villingen die harte Zeit?
„Wir sitzen nie alleine hier“
Schwester Lore ist 69 Jahre alt, sie hat die Gesamtleitung über das stattliche Ensemble von Häusern und Gärten unter dem Namen Tannenhöhe. Feinweiße Haarsträhnen rahmen ihr gütiges Gesicht mit klugen Augen ein. Viele Villinger Kinder kennen die gebürtige Schwäbin noch von der Kita. Lore, wie die Kinder sie nannten, war früher Erzieherin und leitete das kleine Kinderparadies.

Dankbar berichtet sie von der Impfung aller Mitschwestern und Mitarbeiter vor wenigen Tagen. „Angst hatten wir nie. Wir sitzen nicht alleine hier, wir haben unseren Glauben.“ Das sagt sie mit größter Selbstverständlichkeit. Sie entdeckt sogar das Positive dieser Zeit, die vielen draußen als Monate des Horror erscheint. „Das alles hat auch sein Gutes, wir sind zusammengerückt.“
Was Resilienz ist, weiß man hier schon lange
Wir, das sind derzeit 49 Schwestern. Sie arbeiten in der Kita, in der Pflege der alten Schwestern oder im majestätischen Gästehaus mit dem prachtvollen Speisesaal. Die Schwestern bilden eine evangelische Kommunität. Ihre Ursprünge liegen im Pietismus als einer machtvollen Bürgerinitiative des 18. Jahrhunderts. Deren weibliche Mitglieder verzichten freiwillig auf Familie und Mann. Diakonissen leben also ähnlich wie katholische Nonnen.

Manchem erscheint das altmodisch. Dabei ist es gerade anders herum: Die Diakonissen bilden eine geschlossene Gemeinschaft, die etwas hat, worum sie andere beneiden: eine Widerstandskraft, die sich aus einer höheren Quelle speist. Was heute in Kursen zur Persönlichkeitsbildung angeboten und teuer verkauft wird, haben die Frauen auf der Tannenhöhe längst im Gepäck. Zum Beispiel Resilienz. Ihre Großfamilie, wurzelnd in mystischen Lehren einiger schwäbischen Gottesfreunde, ist stabil.
„Wir haben ja unsere sozialen Kontakte“
Der theologische Kopf ist eindeutig Schwester Magdalene Schmidt. Sie studierte Theologie in Tübingen am Neckar und wohnte im Albrecht-Bengel-Haus. Die Schwester trägt die ältere Variante der Diakonissen-Haube, erkennbar an einer breiten weißen Schleife unter dem Kinn.
Die Coronazeit erlebt sie so: Es gab auch Furcht in den Reihen der Frauen, auch Verzweiflung. „Wir erleben das ganze Spektrum der Gefühle – von Angst bis Gleichgültigkeit“, berichtet sie über die vergangenen 13 Monate. Doch war der Zusammenhalt stärker als die vereinzelte Furcht. „Wir haben ja unsere sozialen Kontakte, wir sind versorgt, schauen nacheinander. Hier ist keine allein.“
Hoffen auf den lebendigen Gott
Auch sie hofften auf das Impfen. Aber wohl nicht in der übersteigerten Erwartung, in der manche andere auf den Termin warten. Schwester Magdalene bringt es auf den Punkt: „Ich hoffe nicht auf den Impfstoff, ich hoffe auf den lebendigen Gott.“ Ein elektrischer Satz. Doch Studien zeigen in diese Richtung: Religion und Gemeinschaft kann positiv auf das Immunsystem wirken. Ein Schutzmantel, auch ohne Madonna. Gerade weil sie an Gott glauben, ist der Impfstoff nur Impfstoff – und kein Zeichen der Erlösung.
Mit Magdalene ist gut diskutieren. Sie packt starke Argumente an und spricht unerschrocken Schwäbisch. Sind Pietisten die Fundis am Rande der evangelischen Kirche? Sie antwortet, während Sie ihr Gegenüber scharf durch dicke Gläser fixiert: „Darf ich provozieren: Ich stehe auf einem Fundament.“
Was man nie hatte, wird man nie vermissen
Fundament – das ist hier die Bibel, die Predigt von Magdalene, das gemeinsame Leben. Weil außer Gästen und den damit verbundenen Einnahmen nichts fehlt, ist dieses kleine Dorf stabil. Das Leben hier hat sich seit dem ersten Lockdown weniger verändert als das Leben der meisten Menschen draußen. „Wir gehen nicht mehr in die Stadt“, berichtet Schwester Lore. Sie besuchen nicht mehr ihre Familien, sie verzichten auf eine Städtereise, die sie in ihrem Urlaub (6 Wochen) sonst unternehmen würden.
Und sonst? Der geografische Radius der Frauen auf der Tannenhöhe ist seit jeher klein. Sie setzen sich selten ins Flugzeug. Sie buchen keine Kreuzfahrt, besitzen keine Ferienwohnung, fahren keinen Sechszylinder. Sie besitzen vieles nicht, von dem andere glauben, man müsse es besitzen. Und sie haben keine wehleidigen Männer zuhause sitzen, die in querdenkender Weise über vermeintliche Freiheitsberaubung quengeln. Die Diakonissen schöpfen ihre Freiheit aus dem Leben mit der Bibel. Das ist ihre – völlig legale – Überlebensdroge.
Schwaben in Baden, das geht auch
Die Tannenhöhe ist ein starkes Stück Schwaben im starken Baden. Doch leben die Damen nicht von Luft und Gottesliebe allein. Sie sind auch gute Rechnerinnen und erkannten schnell, dass der größte Haushaltsposten seit Monaten flachfällt: das Gästehaus mit seinen 63 Betten. Wie alle Hotels steht auch der Prachtbau wegen des Virus leer.
Damit fehlen jene Einnahmen, von denen die 49 Schwestern leben. Dann machten sie eine ungeahnte Entdeckung: Stammgäste und Freunde überweisen bis heute Spenden, obwohl sie 2020 kaum ein Bett in Anspruch nehmen konnten. Außerdem schießt das Mutterhaus in Aidlingen (Kreis Böblingen) zu, wenn es knapp wird.
Zur Jahrhundertwende um 1900 war das Haus gegründet worden – damals noch als Grand Hotel mit dem Schwarzwald als unmittelbarer Nachbar. Auch der Großherzog von Baden, der gute Friedrich I. mit dem Rauschebart, logierte hier, um sich an würziger Luft zu erbauen. Dann kamen Jahre des Verfalls und der zerronnenen Vermögen. Nach Kriegsende 1945 brachten die Besatzungsmächte dort versprengte polnische und russische Zwangsarbeiter unter. Ein Haus wie ein Geschichtsbuch.
Vom Grand Hotel zum christlichen Gästehaus
Dem folgten, wenn man so will, himmlische Mächte. 1950 übernahmen die Schwestern aus Aidlingen das damals demolierte Anwesen. „Damit hat das Problem des Waldhotels endlich eine Lösung gefunden“, schreibt der SÜDKURIER am 27. Mai 1950 mit hörbarem Aufatmen. Die Sache war in württembergischen Händen und damit in trockenen Tüchern. Mit gesundem Gottvertrauen und dem Menschenvertrauen in eine solide Buchhaltung gingen die Diakonissen ans Werk.
Aus der noblen Herberger formten die Schwestern ein christliches Gästehaus. Daneben bauten sie ein Haus für sich und speziell die alten Schwestern. Sie arrondierten, bilanzierten, restaurierten. Sie schufen einen Erholungsort zwischen Wald und Weihnachtsoratorium. Zu Fuß geht man 40 Minuten in die Villinger Innenstadt.
Warum wird eine Frau Diakonisse?
Auch ein ehemaliges Kindersanatorium kam hinzu. Heute sitzt in dessen Räumen eine gut besuchte Kita. In deren Büro schaut Schwester Rebecca über ihre Tabellen. Sie leitet die Einrichtung. Ein munteres Gesicht unter der charakteristischen weißen Haube blitzt uns entgegen.
Wie die katholischen Orden haben auch die Aidlinger Schwestern ihr Nachwuchsproblem. Schwester Lore erinnert sich: „Zu meiner Zeit waren es acht oder zehn Frauen, die nachrückten. Heute ist es noch eine.“ Rebecca gehört mit 38 Jahren klar zu den Jüngeren. Die Frauen in den grauen langen Kleidern denken oft über die Gründe dafür nach. „Das liegt auch am Multioptionsdenken“, meint Lore: Junge Menschen wollen sich möglichst nicht festlegen und alles offenhalten. Eine Diakonisse bindet sich, sie verzichtet auf Mann, Kind, Eigenheim.
Die Kunst des Überlebens
Als ich mich verabschiede, stehen die beiden Chefinnen wieder kerzengerade vor mir. Der April macht seinem Namen alle Ehre, ein verspäteter Winter überzuckert die Landschaft und die Giebel der Tannenhöhe. „Man kann hier besser überleben“, sagt Schwester Magdalene nebenbei, als ob sie über einen Sack Kartoffeln redet.
Lore weiß schon, was sie nach dem Überleben tun werden: „Wir werden im Park ein richtig großes Fest feiern, für alle.“