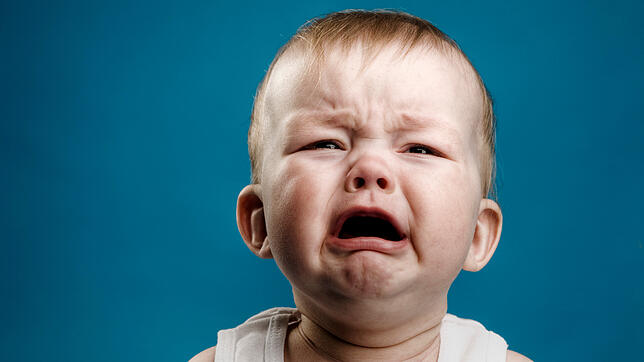Fremden Gesprächen zu lauschen, ist nicht immer angenehm, aber dieser Austausch war einfach zu interessant. Im Regionalzug erzählte ein junger Mann von seinem Einsatz als Techniker bei einem Bekannten. Der hatte sich zuvor einen Fernseher gekauft und schwer über das unscharfe Bild gejammert. Die Kunden-Hotline hatte nicht helfen können, jetzt sollte also der Fachmann ran – wenn überhaupt noch was zu retten wäre.
Ganz furchtbar sei das ja alles mit diesem teuren, neuen Apparat. Der Techniker fuhr also nach Feierabend zu seinem Bekannten, analysierte die Lage kurz, zog die Schutzfolie vom Bildschirm und fuhr wieder nach Hause.
Hilflosigkeit simulieren, jammern nicht vergessen
Ich habe sehr lachen müssen, als ich diese kleine Geschichte hörte. Ich konnte mir die Szene im Wohnzimmer dieser Leute lebhaft vorstellen. Doch je mehr Haltestellen hinter mir lagen in diesem Regionalzug, desto weniger lustig wirkte die Episode auf mich.
Mich machte sie nachdenklich, weil sich in dieser Geschichte die Verfassung unserer deutschen Gesellschaft widerspiegelt: Hilflosigkeit simulieren, jammern nicht vergessen, nach einem Dritten rufen, der alle Probleme löst – und bloß nicht selber nachdenken und sich anstrengen, obwohl das häufig reichen würde.
Wir müssen anfangen, anders zu denken
Natürlich, in unserem herrlichen Land schiebt sich gerade allerlei Mist den Berg runter, da kommt man mit Schönfärberei auch nicht weiter. Exportweltmeister? War einmal. Schnelles Internet? Platz 26 unter den entwickelten Ländern der Erde. Weltweite Patentanmeldungen? Nur noch Platz 5. Digitalisierungsgrad der öffentlichen Verwaltung? Platz 18 unter den EU-Staaten. Infrastruktur? Reden wir mal nicht darüber, sonst stürzen noch mehr Brücken ein.
Die deutsche Bevölkerung kannte seit den Fünfzigerjahren eigentlich nur eine Richtung, nämlich die nach oben. Alles wurde mehr, schöner, größer und nun geht es in die andere Richtung. Doch anstatt sich auf diese Richtung einzustellen und sich zu verändern, trauern alle dem Vergangenen nach und jammern und jammern und jammern. Ist das menschlich? Ja. Hilft es weiter? Nein. Und einen Weg zurück ins Schlaraffenland wird es auch nicht geben. Wir müssen anfangen, anders zu denken.
Raus aus der Komfortzone
Die größte Herausforderung dabei ist der klare Blick aufs Tatsächliche. Darauf, dass vertraute Gewissheiten ihre Gültigkeit verloren haben. Dass unser Parteiensystem doch nicht so stabil ist wie lange gedacht, Frieden auf dem Kontinent doch keine Selbstverständlichkeit ist und eine brummende Wirtschaft auch nicht gottgegeben.
Wer dem Gedanken nachhängt, diese alten Gewissheiten wiederherstellen zu können, der ist nicht nur ein Träumer, der ist Realitätsverweigerer. Oder – wie es Psychologen sagen – der hat es sich in seiner Komfortzone gemütlich gemacht.
Wie das gemeint ist? Die Antwort füllt ganze Regalmeter von Fachliteratur, aus der Sicht eines Laien lässt es sich so erklären: Gewissheiten, auch die des kollektiven Gedächtnisses einer Gesellschaft, schaffen Kontrolle und Sicherheit und bedienen damit ein Urbedürfnis der menschlichen Seele. Sobald diese Gewissheiten wanken, droht Kontrollverlust, und die Menschen verlieren im Wortsinn die Beherrschung.
Um diesem klammen Gefühl zu entrinnen, sehnen sie sich nach vertrauten Verhältnissen und verharren in alten Denkmustern. Sie bleiben in ihrer Komfortzone, die suggeriert, dass es einem dort besser geht. Die Menschen vermeiden also tendenziell, sich Neuem zu stellen und bleiben im Kopf bei Altem und Gewohntem. Vermeidungsstrategie nennen das Psychologen und wissen: Die führt immer dann ins Verderben, wenn die äußeren Bedingungen eigentlich ein nach vorne gerichtetes Handeln erfordern.
Eine Vermeidungsspirale kommt in Gang
Ein großes Problem ist zumeist, dass unsere maßgeblichen politischen Entscheidungsträger diese Illusion aufrechterhalten, dass es sich weite Teile der Gesellschaft auch weiterhin in dieser Komfortzone gemütlich machen können, dass das Kommende schon nicht so neu und ungemütlich werden wird.
Klar, Politik will gewählt werden, wir können es im bereits tobenden Wahlkampf für den Bundestag beobachten. Ein Versprechen jagt das nächste, und echte Härten – wie eine Agenda 2010 des Altkanzlers Gerhard Schröder – sind nicht bekannt. So kommt etwas in Gang, das man Vermeidungsspirale nennen könnte, und die – siehe oben – führt eher ins Verderben als ins Glück.
Der Klimawandel bedroht alle, alternative Energien müssen kommen. Deutschland ist ein Einwanderungsland, der Zuzug sichert unsere Gesellschaft mit ab. Der Verbrenner in unseren Autos wird abgelöst werden, es ist nur eine Frage der Zeit. Junge Menschen sind nicht faul, sie haben nur andere Vorstellungen.
Wer diese vier Wahrheiten bejammert und denkt: Atomkraftwerke lieber wieder anschalten, die Zuwanderung beenden, Verbrenner für immer sichern und den jungen Leuten in den Allerwertesten treten, der bewegt sich in seiner gedanklichen Komfortzone und will sich nicht mit neuen Gegebenheiten auseinandersetzen. So geht Fortschritt nicht, weder politisch noch im Kopf jedes Einzelnen. Parteien und Menschen, die versprechen, die Vergangenheit wieder herstellen zu können, sollte man misstrauen – sie lügen.
Alle sollen sich ändern, nur ich nicht
Deutschland ist noch immer die drittgrößte Volkswirtschaft der Erde, wir sind immer noch Taktgeber der Europäischen Union, auf uns schaut die Welt. Wir haben einen Grad an Wohlstand erreicht, den es so noch nie gegeben hat. Fast 60 Prozent der Deutschen sind mit ihren Lebensumständen zufrieden, so das Institut für Demoskopie Allensbach, einige von ihnen schätzen die Lage des Landes aber schlechter ein als ihre eigene Situation.
Die wahrnehmbare Jammerei darüber ist eher Ausdruck einer diffusen Angst vor Verlusten als von tatsächlich erlittenen Einbußen. Oder übersetzt: Ändern soll sich alles, nur nichts bei mir. Es ist noch reichlich Luft auf dem Weg nach unten, und die sollten wir nutzen. Was also muss sich ändern? Drei Vorschläge:
Klartext reden
Wir brauchen einen breiten Diskurs darüber, was es bedeutet, seine Komfortzone zu verlassen und was das für Folgen hat. Es ist nicht richtig, die Bürger – vor allem in Wahlkampfzeiten – in Watte zu packen und mit falschen Versprechen zu verführen. Wenn draußen der Sturm pustet, kommt man nur voran, wenn man sich dem Wind entgegenstemmt und sich nicht auf dem Sofa verkriecht. Kopf hoch, Ärmel hoch, A… hoch!
Zumutungen formulieren
Mit großen Worten haben Politiker uns nach Corona-Pandemie und russischem Angriffskrieg in der Ukraine Wohlstandsverluste verkündet. Die aber sind flächendeckend gar nicht eingetreten, wenn man den Demoskopen folgt. Große Spareinschnitte werden immer nur formuliert, tatsächlich aber nicht umgesetzt – und am Ende lebt Deutschland, auch der Sozialstaat, über seinen Verhältnissen. Auch der Staat selbst muss sich mäßigen und Kosten senken.
Leistung einfordern
In der Bundesrepublik hat sich die Erwartung breit gemacht, dass andere die eigenen Probleme lösen sollten: der Staat, der Arbeitgeber oder irgendein anderer Dritter. Ob das Kinder-Betreuung ist, hohe Stromrechnungen sind oder belastende Arbeitszeiten. Diese Vollkasko-Mentalität lähmt das, was wir früher als Leistungsgesellschaft bezeichnet haben. Wir sollten das Verhältnis von Fordern und Fördern in unserem Land neu bewerten.
Die Wahrheit ist: Die vor uns liegenden Zeiten werden hart und wir müssen da durch. Wir haben die Wahl, ob wir währenddessen lächeln und anpacken oder jammern und von früher träumen. Ich empfehle uns Lächeln. Von Jammern ist noch niemand glücklich geworden, auch nicht vor dem Fernseher, wenn die Schutzfolie noch drauf klebt.