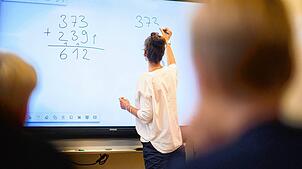Er droht. Er schlägt. Er vergewaltigt. Frau und Kind haben Todesangst. Die Polizei kommt, verweist ihn aus der Wohnung – für zwei Wochen. Dann steht er wieder vor der Tür. Sie flieht, beantragt Beschlüsse, wechselt Nummern, sucht einen Platz im Frauenhaus. Alles voll. Er bleibt – und macht weiter.
Szenen wie diese sind Alltag in Deutschland: 2023 wurden mindestens 155 Frauen von Partnern oder Ex-Partnern getötet, Hunderttausende erleben Gewalt. Tag für Tag für Tag. Seit Jahren aber liegt die Verantwortung für ihren Schutz bei den Opfern, nicht bei den Tätern. Und genau das soll sich nun ändern – mit einer Reform des Gewaltschutzgesetzes, die Justizministerin Stefanie Hubig jetzt vorgelegt hat.
So richtig wie überfällig
Hubig will das Gewaltschutzgesetz reformieren. Zwei Maßnahmen stehen im Mittelpunkt: In Hochrisikofällen sollen Täter eine elektronische Fußfessel tragen. Außerdem sollen Familiengerichte Anti-Gewalt-Trainings nicht länger nur empfehlen, sondern verpflichtend anordnen können. Beides verschiebt die Logik – hin zu den Tätern. Und das ist erstmal so richtig wie überfällig.
Die elektronische Fußfessel – die letzte Bastion gegen wild-entschlossene Täter – soll endlich flächendeckend kommen: Ein Sender am Bein des Täters, gekoppelt mit einem Gerät bei der Frau, löst Alarm aus, sobald er sich nähert. Spanien setzt dieses System seit 2009 breit ein: Ende 2023 waren dort mehr als 4500 Männer unter Kontrolle – ja, wirklich nur Männer.
Nach Angaben der Behörden wurde keine Frau getötet, die durch eine Fußfessel geschützt war. In Deutschland dagegen rechnet das Justizministerium nur mit rund 160 Fällen gleichzeitig. Während Spanien also konsequent auf eine breite Anwendung setzt, plant Deutschland für ein Minimum.
Nicht alle Opfer kann man retten
Fest steht: Eine Fußfessel wird niemals leichtfertig angeordnet. Sie greift nur nach richterlicher Entscheidung und nur in Hochrisikofällen. Wer sie tragen muss, hat andere zuvor in Todesangst versetzt. Für diese Täter gilt: Die Sicherheit der Opfer geht vor, sie verlieren Freiheit.
Aber die Maßnahme erreicht nur Frauen, die zuvor ein Annäherungsverbot erwirkt haben. Viele der späteren Femizid-Opfer hatten diesen Schritt nie gewagt – aus Angst, Scham oder Abhängigkeit. Für sie wäre auch das neue Instrument keine Hilfe gewesen.
Worthülse im Entwurf
Noch entscheidender ist die Täterarbeit. Zwar können Gerichte schon heute im Straf- oder Familienrecht Auflagen erteilen, doch in der Praxis passiert das selten – nicht aus Nachlässigkeit, sondern weil es kaum Angebote gibt. Der Entwurf schreibt zwar vor, dass Täter künftig an Anti-Gewalt-Trainings teilnehmen sollen, lässt aber offen, wer sie bezahlt und wie sie flächendeckend aufgebaut werden.
Anders als in Österreich, wo Männer nach einer polizeilichen Wegweisung sofort verpflichtend ein Training beginnen müssen, setzt der deutsche Entwurf auf richterliche Einzelentscheidungen – und greift damit deutlich später.
Genau darin liegt die Schieflage: Er erklärt Täterarbeit zum zentralen Baustein, obwohl es sie kaum gibt. Prävention darf aber nicht von der Kassenlage klammer Kommunen abhängen. Sie ist eine nationale Sicherheitsfrage.
Vorher statt Nachher investieren
Woher das Geld kommen soll, wird schnell klar, wenn man die Rechnung mal aufmacht. Der Bund kalkuliert rund 10,9 Millionen Euro jährlich für die Fußfessel. Das klingt nach viel – ist aber verschwindend wenig im Vergleich zu den tatsächlichen Schäden.
Gewalt gegen Frauen verursacht in Deutschland jedes Jahr Schäden in Milliardenhöhe. Laut einer aktuellen Studie des Europäischen Instituts für Gleichstellungsfragen sind es rund 54 Milliarden Euro. Das ist natürlich eine politische Zahl.
Aber wie man es auch rechnet: Jeder einzelne Femizid bedeutet Millionen für Ermittlungen, Strafverfahren, Haft, Jugendhilfe, Sozialleistungen für Hinterbliebene. Wer an Prävention spart, zahlt am Ende ein Vielfaches. Das Geld, das im Strafvollzug verpufft, wäre besser angelegt, bevor Gewalt eskaliert.