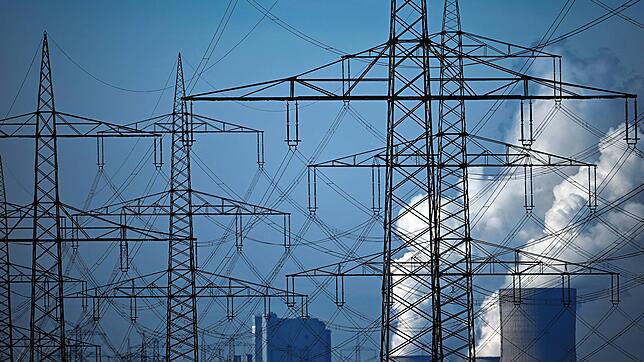Herr Saurugg, Sie sind Blackout-Experte und warnen schon lange vor den Gefahren eines länger anhaltenden Stromausfalls. Wegen des Ukraine-Kriegs ist die Lage im Gas- und Stromsektor angespannt. Wie schätzen Sie die Situation ein? Müssen wir uns Sorgen machen?
Die Lage ist tatsächlich sehr brisant. Wir hatten im Winter ein Riesenglück, weil Januar und Februar sehr milde Monate waren und wir dadurch weniger Gas benötigt haben als normal um diese Zeit. Wenn es kriegsbedingt aber zu einer Unterbrechung in der Gas-Pipeline kommt, haben wir in wenigen Wochen ein großes Problem. Und das nicht nur bei der Gasversorgung, sondern auch in der Lebensmittelproduktion und der Stromversorgung.
Warum dort?
Weil zwei Drittel der Lebensmittelproduzenten Gas brauchen, um die Produktion sicherzustellen. Und auch beim Strom brauchen wir Gaskraftwerke, um Spitzenlasten abdecken oder rasch verfügbare Regelenergie abrufen zu können. Das macht die Situation so kritisch.
Was passiert bei einem Blackout?
Ein Blackout wäre ein mehrere Staaten betreffender Stromausfall, der binnen weniger Sekunden auftreten kann und dazu führt, dass alle anderen Versorgungsleistungen ebenfalls ausfallen. Beginnend mit der Telekommunikationsversorgung, wodurch nicht nur Handy, Festnetz und Internet ausfallen, sondern auch das ganze Geldsystem, etwa die Kassen in den Supermärkten und Tankstellen. Das gesamte Leben kommt zum Stillstand.
In gewissen Regionen funktioniert wegen des fehlenden Stroms auch die Wasser- und Abwasserversorgung nur noch eingeschränkt oder überhaupt nicht mehr. Unser Gesundheitssystem wäre betroffen – und auch die Produktion in den Unternehmen. Wir hätten einen Lieferketten-Kollaps.
Und: Wenn beim Ausfall Schäden an den Produktionsanlagen entstehen, würde es auch nach dem Blackout lange dauern, bis alles wieder hochgefahren werden kann. Weil es gar nicht die Dienstleister gibt, die die entstandenen Schäden überall gleichzeitig reparieren könnten. Ein Strom-Blackout wird daher sehr häufig unterschätzt und oft nur auf den Stromausfall reduziert betrachtet. Das ist viel zu wenig.
Sie zeichnen ja ein düsteres Bild. Kann man sich als „Normalbürger“ auf einen solchen Blackout überhaupt vorbereiten?
Ja, wir müssen es sogar. Wir wissen aus Untersuchungen, dass rund ein Drittel der Bevölkerung sich spätestens ab dem vierten Tag und ein weiteres Drittel spätestens nach einer Woche nicht mehr selbst versorgen kann. Und bei einem großflächigen Stromausfall, wo die Logistik zusammenbricht, wird es Schätzungen nach mindestens zwei Wochen dauern, bis die Produktion wieder breiter starten wird können.
Wenn da aber schon zwei Drittel der Bevölkerung um ihr Überleben kämpfen, wird es an Arbeitskräften fehlen, die das Ganze wieder hochfahren könnten. Wir hätten so einen Teufelskreis, der nur schwer zu durchbrechen wäre.

Heißt: Im Grunde müssten wir eigentlich alle für 14 Tage vorsorgen?
Genau, ich weiß, viele Menschen glauben, sie könnten in einem solchen Fall sowieso nichts machen. Aber, wenn sich jeder zumindest für 14 Tage selbst versorgen könnte, wäre viel gewonnen. Das geht mit ganz einfachen Dingen, wie mit Wasser, Nudeln, Reis oder Konserven.
Wenn der Strom wieder da ist, kann man auch wieder kochen, aber es wird kaum etwas zu kaufen geben. Meiner Erfahrung nach sind auch die Gemeinden und Unternehmen auf ein solches Szenario kaum vorbereitet. Hier wäre ein erster Schritt, einfache Organisationsabläufe zu erstellen und die Mitarbeiter zur Vorsorge zu sensibilisieren.
Wie erklären Sie sich, dass wir in einer so angespannten Lage gelandet sind? Hätte die Politik früher Weichen stellen müssen?
In der Politik hat man die Eskalationsgefahr, die von Russland ausgeht, lange unterschätzt. Ich glaube auch, dass man die Möglichkeit eines Strom-Blackouts kaum durchgespielt hat. Erst kürzlich habe ich wieder gehört, man könne auf zwei Drittel des russischen Gases verzichten. Das ist völlig illusorisch. Wir sind uns nicht bewusst, welche Energiemengen wir heute benötigen. Oder dass wir sie so kurzfristig nicht von woanders importieren können.
Für den Import braucht es eine Infrastruktur, die momentan auf Russland ausgelegt ist. Für eine neue Infrastruktur braucht es Zeit, das geht so kurzfristig und vor allem technisch einfach nicht. Entscheidend ist, dass wir anfangen zu akzeptieren, dass solche Blackouts möglich sind, sodass wir davon nicht völlig überrascht werden. Zumal es in der Vergangenheit schon bedenkliche Ereignisse gab.
Welche?
Allein vergangenes Jahr gab es zwei Ereignisse. Zwei von fünf Großstörungen der vergangenen Jahrzehnte: Das waren 2003 ein gekapptes Netz in der Schweiz, Experten nennen das Netzauftrennung, und dadurch ein Blackout in Italien. 2006 eine Störung quer durch Europa, 2015 ein Blackout in der Türkei. Und dann vergangenes Jahr im Januar eine Überlastung in Kroatien und im Juli eine Netzauftrennung zur Iberischen Halbinsel.
Das zeigt, wie fragil unser Stromnetz sein kann. Zumal unser Stromversorgungssystem, das momentan aus 29 Ländern besteht, nun auch mit der Ukraine verbunden ist. Und dort gab es bereits 2015 einen Cyberangriff, der das Stromnetz ausgeschaltet hat. Mit Cyberangriffen müssen wir auch immer rechnen. Gerade deswegen wäre es wichtig, dass die Politik einen Blackout auch thematisiert und die Situation nicht schönredet oder verharmlost. Denn: Das führt letztendlich genau ins Gegenteil, in die Katastrophe, weil sich die Bevölkerung dann eben nicht damit auseinandersetzt – und keine Vorsorge trifft.