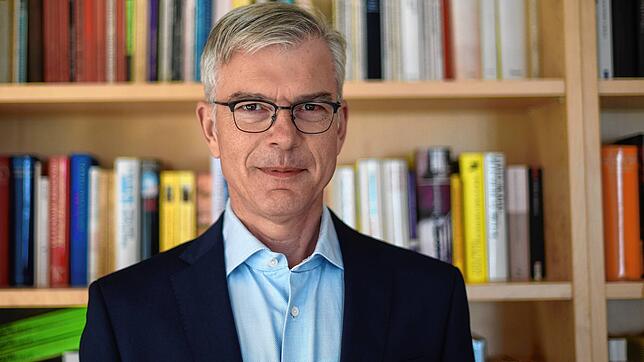Herr Werding, die geburtenstarken Jahrgänge kommen ins Rentenalter – auch Sie gehören dem Boomer-Jahrgang 1964 an. Wenn Sie die Wahl hätten: Würden Sie lieber heute oder in 30 Jahren in Rente gehen?
Ich habe noch nicht darüber nachgedacht, wie es wäre, mein Alter nochmal 20 Jahre zurückzudrehen, was ich aber weiß, ist: Wir müssen in den nächsten Jahren eine ganze Menge richtig machen, um das Rentensystem nicht an die Wand zu fahren.
Ich bin aber überzeugt, dass wir das schaffen. Meine eigenen Kinder werden zwar erst in etwa 50 Jahren in Rente kommen, aber es ist notwendig, sich auch für die Interessen dieser jungen Generation einzusetzen.
Weil diese von der Politik ignoriert wird?
Sie wird zumindest nicht genügend gehört. Wir machen zurzeit viel Politik für die Generation 55 plus. Es besteht die Gefahr, dass die Jüngeren dabei über den Tisch gezogen werden.
Mit welcher Entwicklung bei den Sozialbeiträgen müssen wir rechnen, wenn man am bisherigen Kurs festhält?
Berechnungen, in die Demografie und künftiger Arbeitsmarkt mit einfließen, zeigen Ergebnisse, die – diplomatisch gesprochen – bestenfalls sehr ungünstig sind. Unter dem jetzt geltenden Recht müssen die Sozialbeiträge massiv ansteigen.
Wir sind heute schon – Beiträge für Rente, Pflege, Gesundheit und Arbeitslosenversicherung addiert – bei 40 Prozent des Bruttolohns. Das galt früher mal als absolute Obergrenze. Die Entwicklung geht nun relativ schnell Richtung 45 und 50 Prozent, schon in den nächsten zehn bis 20 Jahren. Wenn man vom Rest auch noch die Lohnsteuer zahlen soll, darf man gespannt sein, was da netto noch übrig bleibt.
Düstere Aussichten vor allem für die Jüngeren?
Sicher. Denn in Deutschland ist die demografische Alterung eine Nummer härter als in den meisten Nachbarländern. Wenn man sinkende Löhne in Kauf nähme, um die Arbeitskosten nicht zu stark steigen zu lassen, dann stellt sich die Frage, ob es in einem offenen europäischen Arbeitsmarkt für jüngere Deutsche noch attraktiv ist, im eigenen Land zu arbeiten.
Die Finanzlücke in der Alterssicherung ist riesig. Mit fast 100 Milliarden Euro jährlich fließt ein erheblicher Teil des Bundeshaushalts ins Rentensystem. Wie lange kann die Politik das durchhalten?
Der Bundeszuschuss wird ansteigen in dem Maß, in dem sich die Renten erhöhen. Der vor Corona erwogene Gedanke, den Rentenbeitrag bei derzeit 18,6 Prozent einzufrieren und nur die Steuermittel zu erhöhen, würde den Bundeszuschuss bis 2040 nochmal um 100 Milliarden Euro nach oben treiben – in heutigen Preisen.
Das ist nicht zu leisten, da müssten die Steuern erhöht werden. Die Lasten würden so nur hin und her geschoben. Wir müssen uns also ehrlich machen.
Das heißt?
Zum Beispiel sollte man den Leuten nicht versprechen, dass das Rentenniveau immer bei 48 Prozent der Bruttolöhne bleiben wird. Denn es ist einfach nicht klar, wo das Geld herkommen soll – ob aus Beiträgen oder vom Steuerzahler. Ich weiß, es ist unpopulär: Auch das Renteneintrittsalter muss zum Thema werden.
Sie sind mit dem Vorschlag einer Rente mit 69 aus der Deckung gekommen . . .
Das Rentenalter wird bis 2031 schrittweise auf 67 Jahre steigen. Bei der neuen Diskussion geht es um die Zeit danach. Wir sollten nicht jetzt den Eindruck erwecken, es könne alles bleiben, wie es ist – und dann in vier Jahren bei den Bürgern eine Enttäuschung provozieren, wenn sich zeigt, dass dem nicht so ist.
Ihre Rente mit 69 wirkt nicht so abschreckend wie Rente mit 70. Aber wie soll das laufen?
Wenn die Lebenserwartung immer weiter steigt, dann ist es im Grunde nicht machbar, das Renteneintrittsalter unverändert zu lassen. Wir empfehlen daher eine Regelbindung.
Konkret: Immer wenn die Lebenserwartung um ein Jahr steigt, werden zwei Drittel davon in zusätzliche Erwerbszeit umgemünzt und ein Drittel in eine längere Rentenlaufzeit. Nach der jetzigen Altersentwicklung kämen demnach in etwa einer Dekade ein Jahr in Erwerbstätigkeit dazu. Wir wären erst 2054/55 bei 69 Jahren. Aber an harten demografischen Fakten kommen wir nicht vorbei.
Was ist mit denen, die schon mit Anfang 60 ihren Beruf nicht mehr ausüben können?
Generell: Zu Regeln, die das Rentenalter anheben, gehören immer auch Regeln für jene, die es bis dahin nicht schaffen. Aber wir sollten die Regeln nicht an den Schwächsten ausrichten, sondern am Normalfall. Den Schwachen hilft eine gute Erwerbsminderungsrente, bei der in den letzten Jahren einiges verbessert wurde.
Und die Zuwanderung hilft uns nicht?
Sie hilft. Das ist in den Berechnungen schon drin. Aber sie ist nicht planbar. So gab es 2008/09 sogar einen Auswanderungsverlust für Deutschland.
Was wäre gewonnen, die Beamten ins Rentensystem einzugliedern, wie DGB und Sozialverbände es fordern?
Aus politischen Gründen wäre es leichter, wenn wir ein gemeinsames Alterssicherungssystem für alle hätten. Aber für die langfristige Finanzierung wäre damit nichts gewonnen. Die Altersstruktur der Beamten und Pensionäre ist genauso schlecht – oder sogar noch schlechter – als die der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten.
Eine Fusion der Systeme bliebe ein Strohfeuer, wenn man vorübergehende Beitragsmehreinnahmen nicht als Reserve auf die hohe Kante legen würde. Bei der Krankenversicherung, wo von oben nach unten umverteilt wird, würde es dagegen einen Unterschied machen, wenn man gutverdienende Selbstständige in die gesetzlichen Kassen integriert.
Wäre es aus Gerechtigkeitsgründen nicht geboten, an das Thema Beamtenpensionen ranzugehen?
Ja. Das System der Altersversorgung für Beamte ist auch nicht tragfähig. An einer Reform müssten aber nicht nur der Bund, sondern auch die Länder mitwirken. Das macht die Sache schwierig.
Wie hoch schätzen Sie die Chance ein, dass sich die Politik zum Handeln aufrafft?
In der letzten Legislaturperiode gab es eine Rentenkommission, die aufzeigen sollte, wie es nach 2025 weitergeht. Das ist in der großen Koalition nicht gelungen. Die neue Regierung ist angetreten nach dem Motto: Beim Rentensystem müssen wir gar nichts tun. Bisher nicht richtig ausgefüllt wurde die im Koalitionsvertrag angesprochene Idee der Ergänzung durch eine kapitalgedeckte Rente.
Arbeitsminister Heil soll laut Koalitionsvertrag bis Jahresende Pläne für eine sogenannte Aktien-Rente vorlegen . . .
Das ist die einzige Alternative zur umlagefinanzierten Rente. Für deren Fortsetzung pur ist unsere Demografie einfach nicht geeignet. Allerdings ist durch Kapitaldeckung frühestens in zehn bis 15 Jahren eine nennenswerte Zusatzrente zu erzielen, da das Kapital zunächst aufgebaut werden muss.
Sie schlagen vor, die Renten nicht mehr an die Lohn- sondern an die Inflationsentwicklung zu koppeln. Was würde das bringen?
Dieser Vorschlag gehört zu einer Ideensammlung, bei der es darum geht, nach 2025 die Ausgaben des umlagefinanzierten Rentensystems einzudampfen, um dessen Finanzierbarkeit zu erhalten.
Man könnte daran denken, die Rente etwas großzügiger als bisher zu bemessen und danach nur noch einen Inflationsausgleich zu zahlen, wie es in vielen Ländern passiert. Das begünstigt einkommensschwache Menschen, die eine unterdurchschnittliche Lebenserwartung haben.
Während der Corona-Phase sind die Löhne gesunken, die Renten wurden aber nicht gekürzt, sondern es gab eine Nullrunde. Lässt sich das den Jungen vermitteln?
Man muss es nochmal sagen: Die jetzige Rentenpolitik ist freundlich zu den rentennahen oder rentenbeziehenden Jahrgängen. Bedenkenswert wäre es daher auch, den Nachhaltigkeitsfaktor, der die demografische Entwicklung bei der Rentenanpassung berücksichtigt, schärfer zu stellen.
Wo sind nach der Rente die größten Baustellen im umlagefinanzierten Sozialsystem?
Problematisch ist die Umlage immer dann, wenn sie gegen Risiken absichert, die mit dem Alter stark zunehmen. Das liegt bei der Rente auf der Hand, aber wir sehen das auch bei der Krankenversicherung, wo für Menschen ab 65 deutlich mehr ausgegeben wird als für Jüngere – etwa das Vier- bis Fünffache. Bei der Pflege ist das Problem noch krasser, weil die zu befürchtenden Steigerungen noch viel größer sind. Grund: Immer mehr Menschen werden älter als 85.
Wenn wir über Zukunft sprechen, sollten wir auch die Zinspolitik einbeziehen. Angesichts extrem niedriger Zinsen über fast ein Jahrzehnt haben viele Ökonomen eine massive Erhöhung der Staatsausgaben für Zukunftsinvestitionen gefordert. Ist so eine Politik angesichts stark steigender Zinsen jetzt noch denkbar?
Gegenüber solchen Forderungen nach höherer Verschuldung war ich immer skeptisch. Denn Sinn machen sie nur, wenn man absolut sicher ist, dass der Zins nie wieder ansteigen kann. Daher muss die Staatsverschuldung begrenzt werden – und dazu gehört auch das Einhalten der Schuldenbremse.