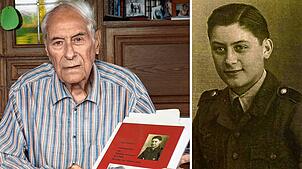Von Oberschwaben bis Südbaden – Seelen werden gerne gekauft und schnell verspeist. Das krustige kleine Brot eignet sich hervorragend zum Vesper, das man mit Käse, Wurst oder Gürkchen zusätzlich füllen kann. Doch woher hat diese Backware den geheimnisvollen Namen? Immerhin steht das Wort Seele für eine mystische Sache. Es geht um den unsichtbaren Geist, der vom Menschen bleibt, wenn er eines Tages nicht mehr sein wird.
Wer dem Wort nachforscht, wird erst einmal mit nüchternem Nichtwissen konfrontiert. „Det wees ick nich“, sagt eine junge Bäckereiverkäuferin in der Konstanzer Innenstadt. Sie stammt aus Berlin und arbeitet in der Brotfiliale, um ihr Studium zu finanzieren. Über den Begriff hat sie sich bisher keine Gedanken gemacht.
Im Namen der Bäckerei
Fündig wird der Neugierige, wenn er in einen Betrieb hineinschaut, der die Philosophie schon im Namen trägt. Der Laden heißt „Laib und Seele“ und sitzt in Konstanz sowie auf der Insel Reichenau. Der Name ist gut gewählt, versteht sich die Reichenau als Insel der Seligen, wo vieles noch so ist wie früher. Das sagen wenigstens die Reichenauer.
Die Bäckerei mit kleinem Café liegt strategisch günstig: Der Parkplatz davor fasst auch Wohnmobile mit Einparkproblemen. Radfahrer kommen zwangsläufig vorbei und lassen sich in die Teig- und Kuchenseligkeit der Bäckerei fallen.
Auf der anderen Straßenseite liegt die Kirche St. Georg mit tausendjährigen Fresken. Kunstfreunde, die von der Pracht erschlagen sind, suchen dankbar die Brotstation auf, die sie wieder auf die Beine stellt.
Ein spiritueller Name
An diesem Tag ist es noch ruhig in „Laib und Seele“. Mitriban Özkan verkauft routiniert Brezeln und Brote und immer wieder eine Seele. Vier verschiedene Varianten liegen in dem hölzernen Regal. Mit Salz und Kümmel, Mohn und Sesam, Speck oder mit kleingeschnittenem Gemüse.
„Es gibt Sonntage, da verkaufen wir 60 Stück von jeder Sorte“, berichtet Geschäftsführerin Özkan. Den spirituellen Namen dieser Brotstangen findet sie herrlich. „Hier kann man die Seele baumeln lassen“, meint sie.
Plötzlich geht die Tür zur Backstube auf. Die Bäckerin verlässt ihren Arbeitsplatz und zieht nach Hause. Cornelia Brutte-Grützmacher beginnt ihre Schicht kurz vor Mitternacht und hört neun Stunden später auf. Dann sind Brezeln, Wecken fertig. Auch die Bäckerin ist bedient, sie freut sich auf die Heimfahrt und drei Stunden Schlaf („Ich schlafe immer in Etappen“).

Über die Salz-und-Kümmel-Stangen hat sie sich Gedanken gemacht. Trotz einem Anflug von Müdigkeit erklärt sie: „Am Allerseelentag wurden Brote auf die Gräber der Verwandten gelegt. Daher kommt der Name Seele.“ Deshalb also der christlich geprägte Begriff. Er erinnert an einen alten Brauch am Tag Allerseelen, der auf den 2. November fällt.
Die Bewirtung der Toten mit Nahrung hat sich in unseren Breiten überlebt. In Mexiko dagegen wird die Tradition bis heute gepflegt. Familien suchen ihre Vorfahren auf und halten an den Gräbern ein rituelles Mahl. In Deutschland würde diese Form von Imbiss auf einem Friedhof auffallen.
Der Volkskundler Werner Mezger bestätigt diese Herleitung des Begriffs. „Das Seelengebäck hat tatsächlich einen theologischen Hintergrund“, sagt er im Gespräch und holt aus: „In diesem Nahrungsmittel wird ein zutiefst menschliches Modell einer Mahlgemeinschaft greifbar.“ Der Brauch zu Allerseelen habe etwas Transzendentes.
Warum gerade Salz und Kümmel auf die Seele gestreut wird, kann der Professor auch nicht erklären. Möglicherweise benötigt man diesmal keine Theologie: „Dann schmeckt sie nicht fade“, sagt Mezger. Abseits der Forschung sagt er: „Eine Seele esse ich für mein Leben gern.“