Was hat ein 1700-Seelen-Ort im Linzgau mit dem Attentat auf Adolf Hitler zu tun, mit der Bombe, die vor 80 Jahren, am 20. Juli 1944, im Führerhauptquartier Wolfsschanze in Ostpreußen explodierte? Auf den ersten Blick: nichts. Man muss genau hinschauen. In diesem Fall: den kleinen Friedhof aufsuchen, der zwischen Wiesen und Feldern wie ein großes Rechteck liegt. Stille. Selten kommt auf der Straße nach Hattenweiler ein Auto vorbei.
Eine „Stätte wachen Gewissens“
Am Eingangstor konkurrieren zwei Hinweise um Aufmerksamkeit. Auf dem grünen Blechschild warnt das Rathaus, dass hier im Winter nicht geräumt und gestreut wird. Die bronzene Platte rechts daneben rückt Zeitgeschichte in den Blick. Hier erklärt das Denkstättenkuratorium NS Dokumentation Oberschwaben den Dorffriedhof zur „Stätte wachen Gewissens“.

Nur wenige Meter davon, links an der Mauer, befindet sich ein unauffälliges Grab. Seine schlichte steinerne Einfassung wurde seit Ende 1945 bewusst nicht verändert. Eine Marmorverkleidung wäre nicht im Sinne der Verstorbenen gewesen, der preußisch-protestantische Sparsamkeit wichtiger war als die vergängliche Pracht einer letzten Ruhestätte.
Nur eine neuere Platte ist in grauem Marmor ausgeführt, ein Vers aus Jesaja, Kapitel 43, eingemeißelt. Darunter der Name der Verstorbenen: Agnes von Haeften – 17.11.1869 – 5.12.1945.
Im Schatten Stauffenbergs
Von Haeften (gesprochen: Haften), ein Name, der engstens mit dem Attentat auf Adolf Hitler am 20. Juli 1944 verknüpft ist und doch meist im Schatten eines anderen blieb: Oberst Claus Schenk Graf von Stauffenberg. Er wurde noch in der Nacht des gescheiterten Putschs im Innenhof des Oberkommandos des Heeres, dem Berliner Bendlerblock, durch Gewehrschüsse hingerichtet.

Neben ihm starb sein Adjutant, Oberleutnant Werner von Haeften. Ebenfalls den Tod fanden die Mitverschwörer General Friedrich Olbricht und Oberst Albrecht Ritter Merz von Quirnheim. Ihre Leichname wurden auf dem Berliner St.-Matthäus-Friedhof beigesetzt, anderntags auf Befehl Heinrich Himmlers exhumiert, verbrannt und auf den Rieselfeldern verstreut. Dort klärte die Stadt ihre Abwässer.
Hans Bernd von Haeften starb am Galgen
Das alles kann man in Büchern nachlesen. Weniger bekannt ist, dass an der Friedhofsmauer hinter dem Grab von Agnes von Haeften seit einigen Jahren eine Gedenktafel aus Bronze an ihre beiden Söhne erinnert: Werner und Hans Bernd, der im diplomatischen Dienst, später als stellvertretender Leiter der kulturpolitischen Abteilung im Reichsaußenministerium gleichfalls im Widerstand gegen Hitler aktiv war.
Er starb zusammen mit anderen am 15. August 1944 in der Hinrichtungsstätte Berlin-Plötzensee am Strang. Stunden zuvor hatte ihn der Volksgerichtshof unter seinem Vorsitzenden Roland Freisler zum Tod verurteilt.

Dort war in der Vernehmung ein Wort von Haeftens gefallen, das Geschichte schrieb. Der Angeklagte hatte Hitler als „großen Vollstrecker des Bösen“ bezeichnet, dies sei die „weltgeschichtliche Rolle des Führers“. Eugen Gerstenmaier, evangelischer Theologe, Mitverschwörer und nach 1945 CDU-Politiker, nannte diese Aussage seines Freundes später „das entscheidende Wort des ganzen Widerstandes“.
Reservistenkameradschaft kümmert sich um das Grab
Neben dem Grab kniet Frieder Kammerer. Heute trägt er statt seiner Polizeiuniform Khaki-Zivil. Einen Teil seiner Freizeit widmet der frühere Bundeswehr-Feldwebel der Reservistenkameradschaft Oberer Linzgau, deren zweiter Vorsitzender er ist. Die 20 aktiven Mitglieder um Roland Pudimat haben nicht nur eine pflegerische, sondern auch eine geistige Patenschaft für das Grab übernommen.

Kammerer wirkte daran mit, dass das Kuratorium diese Stätte in die Reihe der Denk-Orte aufnahm, zu denen auch das Schloss Krauchenwies gehört, wo Sophie Scholl 1941 ihren Einsatz beim Reichsarbeitsdienst ableistete. Kammerer spricht von einem „letzten materiellen Bezugspunkt“ zu den Haeften-Brüdern, die ohne eigenes Grab blieben.
Berliner Freundeskreis mit Folgen
Umso mehr verdichtet sich hier im Linzgau die Erinnerung an die Männer des Widerstandes, ergeben sich in Oberschwaben bei genauem Hinsehen Kontakte und Freundschafts-Netzwerke bis ins Berlin der frühen 1920er-Jahre.
Die Haeften-Brüder wuchsen im großbürgerlich-protestantischen Milieu des Villen-Vororts Grunewald auf. Hier führte Vater Hans von Haeften als Generalstabsoffizier mit seiner Gattin Agnes, einer geborenen von Brauchitsch (Bruder Walther war bis 1941 Oberbefehlshaber des Heeres), ein großes und mit prominenten Nachbarn freundschaftlich verbundenes Haus.

Haeften senior kam 1918 in engen Kontakt mit Prinz Max von Baden, dem letzten Kanzler des Kaiserreichs, und dessen Privatsekretär Kurt Hahn, dem späteren Gründer des Internats Salem.

„Im familiären Alltag tief verankert war die christliche Glaubenspraxis. Sie bildete das Fundament für die spätere Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus“, schreibt Rieke Harmsen, eine Enkelin von Hans Bernd von Haeften, in ihrer Doktorarbeit über das Leben der Brüder. Diese gingen mit Dietrich Bonhoeffer in dasselbe Gymnasium und 1921 zusammen zur Konfirmation. Später studierten beide Jura.
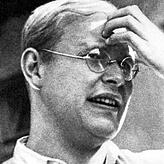
Die Macht des Rechts und ihre Verwurzelung im Glauben begründete – im Unterschied zu vielen anderen Widerständlern – von Anfang an eine Distanz zum Nationalsozialismus. Bonhoeffer, später Theologe und Repräsentant der NS-kritischen Bekennenden Kirche, sollte das gleiche Schicksal wie seine Freunde erleiden. Er starb im April 1945 im KZ Flossenbürg.
Verbindung zu linksintellektuellen Widerständlern
Zu dem in Grunewald gewachsenen Bekanntenkreis der Brüder gehörten weitere Freunde, die sich dem Widerstand gegen Hitler anschlossen, wie Harro Schulze-Boysen, der den linksintellektuellen Kreis der Roten Kapelle um sich sammelte und 1942 in Plötzensee gehenkt wurde. Ein Freund war Martin Niemöller, der streitbare Pfarrer, der acht Jahre im KZ einsaß.
Sich eine unabhängige politische Meinung zu bilden, die von christlicher Moral getragen war, das brachten die Haeften-Brüder aus Berlin-Grunewald in ihr Leben mit. Dass der Mut und die Bereitschaft zum Widerstand gegen Hitler in den Jugendjahren angelegt wurde, das sagt auch Hans von Haeften, ein Enkel von Hans Bernd, im Gespräch mit dem SÜDKURIER. Für seine Überzeugung sein Leben einsetzen, dieser Gedanke sei unserer heutigen Gesellschaft fremd geworden.
Erlaubt Gott den Tyrannenmord?
Haeften, stellvertretender Referatsleiter im Stuttgarter Umweltministerium, betont die Gewissensfragen, die sich die Brüder stellten, nachdem Stauffenbergs Attentatsplan im Frühjahr 1944 Gestalt angenommen hatte und die „Operation Walküre“ in Gang gesetzt wurde. Den Entschluss zum Tyrannenmord teilte der theologisch argumentierende Hans Bernd im Gegensatz zu seinem Bruder indes nicht.
Die Folgen des Attentats vom 20. Juli
„Ist das deine Aufgabe vor Gott?“, zitiert der Enkel die Frage, die sein Großvater dem Bruder stellte. „Wir können nicht mit Gangstermethoden arbeiten“, so der Ältere zum Jüngeren. Der Teufel sei nicht mit dem Beelzebub auszutreiben. Zu dieser Haltung hatte sich der Kreisauser Kreis um Helmuth James Graf von Moltke, dem Haeften angehörte, durchgerungen.
Sprengstoff in der Tasche
Werner, der sich als Kompanieführer in Russland ein Bild vom Ausmaß und den Folgen von Hitlers Größenwahn hatte machen können und 1942 schwer verwundet wurde, hatte diese Kernfrage bereits für sich entschieden. Den Sprengstoff für die Bombe, die Hitler töten sollte, hat er in seiner Tasche. Er ist am 20. Juli als sein Adjutant und Freund fast ständig an Stauffenbergs Seite.

Auf eine eigene Familie, der die Sippenhaft durch die Nazis droht, muss der Offizier keine Rücksicht nehmen – im Gegensatz zum Bruder, der mit seiner Frau Barbara fünf Kinder hat.
Familienangehörige kommen in Sippenhaft
Sie wird nach dem Attentat in der Berliner Haftanstalt Moabit inhaftiert, wo sie bis Ende September einsitzt. Ihre Schwiegermutter Agnes, die von „Walküre“ wusste, bleibt bis Ende August in Haft. Nach Kriegsende nimmt sich Freund Kurt Hahn der durch den Tod ihrer zwei Söhne gebrochenen Frau und ihrer Tochter Elisabeth an. Sie erhalten eine Wohnung im alten Klostergebäude auf dem Hermannsberg bei Großschönach.

Agnes stirbt dort im Dezember 1945. Hahn macht aus der Anlage eine Art Wohnheim für die Angehörigen hingerichteter Widerstandskämpfer. So lebt dort auch der erst 17-jährige spätere Hamburger Bürgermeister und SPD-Politiker Klaus von Dohnanyi.
Im Hegau ist es auch ein Gebäude mit Anfängen im Mittelalter, das Barbara von Haeften und ihren Kindern von 1946 bis Ende 1950 eine neue Heimat gibt: Burg Hohenfriedingen (“Friedinger Schlössle“) bei Singen. Es ist im Besitz ihrer Familie, die sich zwischen rheinischem Unternehmertum und Politik bewegt. Barbaras Onkel Hans Curtius, ein Industrieller, hat das Anwesen in den 1920er-Jahren gekauft und teilweise umbauen lassen.
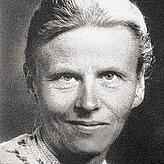
Barbaras Vater ist der frühere liberale Politiker Julius Curtius, bis 1931 Reichsaußenminister. Über ihren Mann hinterlässt die Witwe ein Bändchen mit Erinnerungen: „Nichts Schriftliches von Politik. Hans Bernd von Haeften. Ein Lebensbericht.“ Der Titel bezieht sich auf die Gefahr durch die Spitzel des Nazi-Regimes. Barbara von Haeften stirbt 2006 mit 97 Jahren in ihrem Haus am Starnberger See.





