Frau Gebhardt, Sie erwähnen in Ihrem Buch zwei Fälle von Gruppenvergewaltigung in Berlin im Jahr 1953, an denen einmal 14 und einmal 19 Jugendliche beteiligt waren. Waren Sie überrascht, als Sie auf diese Taten gestoßen sind?
Im ersten Moment war ich überrascht, denn man wird an die Fälle von Gruppenvergewaltigung in der Gegenwart erinnert – wie in Freiburg, aber auch in anderen Ländern wie Indien. Da ich mich aber mit dem Thema sexualisierte Gewalt im Krieg und nach dem Krieg beschäftigt habe, sind mir die Fälle auf den zweiten Blick nicht mehr überraschend erschienen.

Liefen die Vergewaltigungen, auf die Sie in den Gutachten einer Jugendpsychiaterin stießen, nach einem ähnlichen Muster ab?
Die Jugendlichen, die an den Vergewaltigungen beteiligt waren, stammten – und das lässt aufhorchen – aus geordneten Familienverhältnissen. Sie waren zwischen 13 und 19 Jahren alt, hatten einen Anführer, der die Rolle des sexuellen Lockvogels für ein weibliches Opfer spielte. Laut der Aussage eines Mädchens nahm sie zunächst an, es nur mit dem Anführer zu tun zu haben, und musste dann erleben, dass der hinterher die ganze Gruppe aufforderte, es ihm nachzumachen.
Dieses Alpha-Tier der Gruppe hat seine Freunde also animiert oder sogar unter Druck gesetzt?
Ja, die Initiative ging von demjenigen aus, der das Kommando über die Gruppe hatte. Die anderen haben dann mehr oder weniger freiwillig mitgemacht. Diese Gruppendynamik könnte für die jungen Täter selbst als eine Art von Gewalt erlebt worden sein. Sie waren vermutlich dem Druck ausgesetzt, ihre Männlichkeit unter Beweis zu stellen.
Was hielten die Täter von ihren Opfern?
Die Vorstellung war: Es gibt auf der einen Seite junge Frauen, die sind „rein“ und „anständig“, mit denen will man keinen gewaltsamen Sex. Und auf der anderen Seite gab es die Mädchen, die angeblich zum Sex einladen, weil man sie als nicht „anständig“ oder „sittenlos“ betrachtete.
Die Heilige und die Hure also . . .
Ja, das ist in unserer Geschlechterordnung seit sehr langer Zeit ein Stereotyp. Unterschieden wird da zwischen den fast unberührbaren heiligen Frauen wie Maria und den verlockenden sexuell vitalen aber verruchten Frauen, die an Prostituierte erinnern. Das ist ein typisches Erklärungs- und Rechtfertigungsmuster bei sexueller Gewalt gegen Frauen. Die Schuldfrage wird einfach umgedreht und dem Opfer die Verantwortung für die Tat zugeschoben. Nach der Devise: Hätte sich die Frau nicht so unmoralisch verhalten, hätte sie mich auch nicht zur Tat eingeladen.

Welche Rolle spielen Krieg und Nachkriegszeit bei der Erklärung der Brutalität der Kinderbande?
Wir müssen sehen: Die Öffentlichkeit war damals ohnehin alarmiert. Denn sie machte die moralische Gesundung, an der man nach dem Krieg mit Nachdruck arbeitete, an der Jugend fest. Das war der sogenannte „Sittlichkeitsdiskurs“. Es ging darum, die Moralfragen, die sich nach den Verbrechen im Krieg und im NS-Staat stellten, im Grunde abzuwälzen auf Bevölkerungsgruppen, die außerhalb der bürgerlichen Norm standen. Dazu zählten auch Jugendbanden.
Also Jugend als Bedrohung der wieder zelebrierten bürgerlichen Tugenden . . .
Die Jugend als soziale Gruppe wurde nach dem Krieg mit Argusaugen von der Erwachsenenwelt beobachtet. Die Nachkriegsgesellschaft fürchtete, dass sich die Sünden der Väter bei den Nachkommen fortpflanzen könnten. Andererseits gab es aber auch ganz handfeste Gefährdungen für die Jugend.
Was gehörte dazu?
Viele Kinder, die im Krieg geboren wurden, wuchsen ohne Vater auf, weil der gefallen war oder lange in russischer Gefangenschaft. Es gab enorm viele Scheidungen. Viele Mütter mussten allein mehrere Kinder großziehen und hatten vielleicht einen neuen Partner. Die Verwerfungen durch den Krieg setzten sich in den Familien fort. Was den meisten damals aber nicht bewusst war: Kinder waren in einer Atmosphäre der Gewalt aufgewachsen, hatten vielleicht selbst Gewalt und Vergewaltigungen gesehen, vielleicht sogar in der Familie. Die Inzestfälle nahmen zu. Es gab also alle möglichen Phänomene der sexuellen Abstumpfung und Verrohung. Da liegen auch Parallelen mit heutigen Problemen mit jungen Migranten, die ja auch oft in eine gewalttätige Welt hineingeboren wurden.
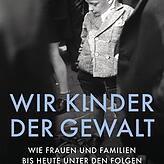
Wie lässt es sich erklären, dass zwischen 1948 und 1952 die allgemeine Jugendkriminalität in Westdeutschland zwar deutlich zurückging, die Anzahl der „Sittlichkeitsverbrechen“ von Jugendlichen aber um 147 Prozent zunahm? Ist das eine Folge genaueren Hinsehens?
Vermutlich. Ich glaube, dass damals in der deutschen Bevölkerung ein sexuelles Trauma saß. Ursachen waren sexuelle Gewalt etwa durch Besatzungssoldaten, aber auch eigene Vergehen in den Reihen der deutschen Wehrmacht, in der auch sexuelle Gewalt vorkam. Auch in den Kriegsgefangenenlagern wurde sexualisierte Gewalt ausgeübt. Dazu kommt, dass die Besatzung durch die Siegermächte von vielen als Demütigung und Erniedrigung empfunden wurde. Überträgt man das auf die Gewalt der Jugendbanden, dann war Gruppenvergewaltigung nicht nur ein reales Thema, sondern auch ein symbolisches. Kurz gesagt: Auch hier spiegelte sich eine Ohnmachtserfahrung.
Waren diese Vorfälle ein städtisches Phänomen oder gab es das auch auf dem Land?
Sorgen um die Sexualität von Kindern und Jugendlichen bestanden überall. Das lässt sich auch in Erziehungsratgebern in dieser Zeit nachlesen, die Eltern aufforderten, bei den „Doktorspielen“ ihrer Kinder genau hinzusehen, denn nur zu leicht werde aus Spiel Gewalt. Diese moralische Panik erscheint uns heute überzogen, aber wir dürfen nicht vergessen, dass damals auch freiwillige Sexualität und homosexuelle Handlungen zwischen Jugendlichen als „Sittlichkeitsdelikte“ kriminalisiert wurden.
Fragen: Alexander Michel



