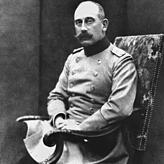Herr Professor Machtan, vor 100 Jahren mussten die deutschen Monarchen ohne Glanz abdanken. Vom Kaiser bis zum Großherzog. Wäre das schmähliche Ende vermeidbar gewesen?
Nach den Quellen, die ich studiert habe, kann ich das mit einem klaren Ja beantworten. Ich entdeckte, dass es Räume für politisches Handeln gab, in denen man die Monarchie hätte erhalten können. Allerdings nicht in der bisherigen Form mit einem starken Kaiser, sondern mithilfe von gründlichen und glaubwürdigen Reformen. Wichtig wäre eine echte Demokratisierung des Systems gewesen – nicht nur eine, die den Forderungen von US-Präsident Woodrow Wilson Rechnung getragen hätte.
Dann wäre der deutsche Kaiser noch zu retten gewesen?
Nein. Das Ansehen von Wilhelm II. war im Sommer 1918 verbraucht. Man hätte also einen Regenten auf dem Thron benötigt, der das Kaiserreich ins Volkstümliche hinein repräsentieren konnte. Unter all diesen Bedingungen hätte das deutsche Reich als Monarchie fortbestehen können, etwa so wie in Schweden oder den Niederlanden.
Können Sie Wilhelm II. einmal kurz skizzieren?
Er war nicht etwa dumm. Er kannte sich in politischen Dingen gut aus und wusste um die personellen Schwachstellen. Vielmehr täuschte er sich über seine Macht. Spätestens mit Kriegsbeginn 1914 musste er erkennen, dass er kein regierender Kaiser mehr war. Die Oberste Heeresleitung nahm ihm die Zügel aus der Hand. Als sich die Niederlagen mehrten, wurde etwas anderes deutlich: Der Mann war manisch depressiv. Aus diesen Löchern musste er immer wieder herausgeholt werden. Das taten seine Umgebung und seine Frau – die Kaiserin Auguste Viktoria. Sie hinderten ihn auch daran, das einzige Vernünftige zu tun, um den Thron zu retten: nämlich freiwillig und zeitig auf den Thron verzichten.
Dann hätte ein anderer Vertreter aus dem Haus Hohenzollern an seine Stelle treten können. Aber wer?
Das war die Frage. Der Kronprinz Wilhelm konnte es nicht sein; dessen Ansehen war noch mehr beschädigt als das seines Vaters. In Frage kam nur sein Enkel, der 1918 erst 12 Jahre alt war. Also hätte man einen Regenten gebraucht, der den Thron kommissarisch betreut – einen Reichsverweser also. Einen Kandidaten dafür gab es.
Sie meinen Max von Baden, der sich dafür ins Gespräch brachte.
So ist es. Er trat mit dem erklärten Willen an, die Monarchie zu retten. Dann geriet er in einen Strudel von Ereignissen, die ihn fortrissen. Das brachte ihn von seinem Rettungsplan ab. Er konnte Wilhelm II. nicht dazu überreden, auf den Thron zu verzichten.
Max von Baden war ein Quereinsteiger.
Er kam von außen, das ist richtig. Er wollte gezielt in die Politik und sah es als seine Aufgabe an, die Monarchie zu retten. Das war ein Stückweit Autosuggestion. Auch seine Berater Kurt Hahn oder der Schwabe Conrad Haussmann redeten ihm ein, dass er der richtige Mann dafür sei.
Und dann?
Prinz Max hatte kein realistisches Bild von der Lage 1918. Er kannte den Berliner politischen Betrieb nicht. Sein Verhältnis zum Kaiser war verquer, obwohl dieser sein Vetter war. Nur durch ein Machtwort des Generals Ludendorff gelangte er ins Amt des Reichskanzlers.
Sie widmeten dem Prinzen Max bereits ein Buch und zeigten, dass er homosexuell war und diese Neigung ein Prinzenleben lang verstecken musste.
Er war ein Überlebenskünstler. Das war seine größte Fähigkeit, die ich an ihm bewundere. Beim Überleben und Verbergen hatte er Helfer. Das ging gut, bis der Erste Weltkrieg ausbrach und er an der Front versagte. Er konnte den Krieg nicht aushalten. Hier beginnt ein biografischer Bruch.
Strebte Max von Baden insgeheim nach dem Kaiserthron?
Nein, er wollte Reichsverweser sein, ein Ersatzkaiser und Platzhalter, wenn Sie so wollen. Auch Friedrich Ebert, der Führer der Sozialdemokraten, ging in diese Richtung. Am Ende traute Max sich nicht. Er wollte Wilhelm II. gegenüber nicht als Verräter dastehen. Und er war zu schwach, um diese Rolle auszufüllen.
Der SPD-Politiker Friedrich Ebert wollte das System der Monarchie gleichfalls erhalten.
Ebert traute dem Volk noch nicht viel zu. Er glaubte, dass die Krone auch nach 1918 für das bessere System steht. Er meinte zu wissen, dass die Bevölkerung so denkt und ihre Fürsten behalten will. Ebert wollte die Monarchie erhalten, aber nicht in der autoritär-preußischen Variante, sondern als parlamentarische Monarchie. Das Kaisertum sollte eingeschränkt fortgesetzt werden. Dafür hat Ebert bis zum Morgen des 9. November 1918 gekämpft – dem Tag der Abdankung des Kaiser.
In Ihrem Buch nennen Sie den Reichstag eine „Werkstatt der Revolution“. Was heißt das?
Bis 1918 hat das damalige Parlament eine politische Nebenrolle gespielt. Der Reichstag konnte Kaiser und Regierung nicht unter Druck setzen. Das änderte sich erst, als sich die Lage dramatisch zuspitzte und die Bevölkerung immer mehr Not litt. In dieser Situation im Oktober 1918 fällt dem Reichstag ein immer größeres Gewicht zu. Erstmals wird dort gefordert, man solle die Monarchie abschaffen und den Sozialismus einführen. Besonders die USPD hat den Reichstag zum Hauptquartier für die Vorbereitung ihrer Revolution gemacht. Am 9. November, dem Tag der Abdankung des Kaisers, ist das Parlament eines der Machtzentren. Die Mehrheits-SPD zieht sich in die Wilhelmstraße zurück. Dort auch wird Friedrich Ebert von Prinz Max zum Reichskanzler ernannt.
Die Revolution von 1918 wird häufig als gescheitert bezeichnet. Stimmt das?
Nein, denn damals entstanden demokratische Strukturen, die Errungenschaften zum Leuchten bringen. Auch soziale Standards werden erkämpft, die man nicht hoch genug bewerten kann. Ich denke an das Frauenwahlrecht, den Acht-Stunden-Tag, die Tarifgemeinschaft. Doch darf man auch die Negativposten nicht übersehen. Es gibt bürgerkriegsähnliche Zustände. Halbfaschistische Männerbünde bilden sich, die mordend durch die Städte ziehen.
Zum Fortschritt damals gehört auch, dass Adelstitel und Adelsprivilegien abgeschafft wurden. Können Sie verstehen, dass die Nachfahren des Hochadels heute noch mit „Durchlaucht“ oder „Königliche Hoheit“ angesprochen werden?
Dafür habe ich kein Verständnis. Dafür bin ich zu sehr Republikaner. Solche Anreden sind höflich gemeint. Sie stehen aber inzwischen in keinem Verhältnis zu dem royalen Charisma, das von den Personen damals ausging. Für mich sind die heutigen Adligen Citoyens, Bürger wie du und ich. Die alten Titel halte ich für aufgesetzt und übertrieben.
Fragen: Uli Fricker
Zur Person
Lothar Machtan, 69, lehrte an der Universität Bremen Geschichte (bis 2015). Sein Schwerpunkt ist das 19. und 20. Jahrhundert, dort gilt sein Interesse vor allem Persönlichkeiten. Aufsehen erregte er vor Jahren mit seiner These von der Homosexualität Adolf Hitlers.
Intensiv beschäftigt er sich auch mit Leben und Wirken von Max von Baden und dessen Zwiespalt zwischen familiärer Verpflichtung und privaten Neigungen. Auch das jüngste Buch von Lothar Machtan nimmt die späte Kaiserzeit ins Visier. Es behandelt die letzten Wochen der Monarchie und heißt: Kaisersturz. Vom Scheitern im Herzen der Macht 1918. (wbgTheiss, 352 S., 24 Euro).
Zwischen Krone und Republik: Fünf Lebensläufe
Wilhelm II.: Der letzte deutsche Kaiser nahm gerne den Mund voll. Er träumte von einer großen Flotte, einem noch größeren Deutschen Reich und vom Glanz der Dynastie der Hohenzollern.
All das inszenierte er als großes Kostümfest mit ihm als Mittelpunkt. Wilhelm (1859-1941) wollte den I. Weltkrieg nicht – er unternahm aber auch wenig, um ihn zu verhindern, obwohl es seine starke Stellung zugelassen hätte.
Auguste Viktoria: Die letzte Kaiserin war für ihre hohen Frisuren und ausladenden Hüte bekannt. Auguste Viktoria war äußerst standesbewusst. Sie genoss das Dasein als Kaiserin, den eigenen Hofstaat.
Und sie übte im Herbst 1918 einen stärker werdenden Einfluss aus. Sie hielt ihren Mann im Amt, während dieser schon früh abdanken wollte. Auguste Viktoria (1858-1922) war von der Monarchie überzeugt.
Großherzogin Hilda: Die Aristokratin aus dem Hause Hessen-Nassau war die letzte Großherzogin von Baden. 1885 hatte sie den späteren Großherzog (ab 1907) Friedrich II. von Baden geheiratet.
Sie war in der Bevölkerung beliebt; bis heute erinnern zahlreiche Hildastraßen und Hildaschulen an die Großherzogin. Ihren Mann überlebte sie um viele Jahre. 1952 starb Hilda. Sie ruht seitdem in der Krypta der Grabkapelle in Karlsruhe.
Max von Baden: Der Prinz (1867-1929) engagiert sich in der Gefangenenfürsorge und vermittelt zwischen den Kriegsparteien. So empfiehlt er sich für die Politik.
Als die Lage im Herbst 1918 brenzlig wird, bringt er sich für das Amt des Reichskanzlers ins Spiel und übernimmt am 3. Oktober. Waffenstillstand aushandeln und die Monarchie retten? Das gelingt nicht. Am 9. November übergibt der Prinz an Friedrich Ebert von der SPD.
Matthias Erzberger: Dem Schwaben fiel in der Phase des Umbruchs die undankbarste Aufgabe zu: Er unterschrieb den Waffenstillstand zwischen Deutschem Reich und Frankreich am 11. November 1918 – damit war die deutsche Niederlage besiegelt.

Die Generäle hatten sich geweigert, ihren Namen unter das Dokument zu setzen. Das kam Erzberger teuer zu stehen, 1921 wurde er ermordet.
Zu gewinnen!
Was passierte zwischen dem August 1914 und dem Ende der Monarchie im Herbst 1918 am Bodensee? Diese Frage beantwortet auf 368 Seiten mit vielen Bildern aus der Region der von Tobias Engelsing herausgegebene Band: Die Grenze im Krieg. Der Erste Welkrieg am Bodensee. Für Abonnenten des SÜDKURIER/Albbote verlost die Redaktion 15 Exemplare. Die Teilnahme unter der Nummer 01379/37050072 bis Dienstag, 20. November, 24 Uhr. Name und Anschrift durchgeben. (mic)