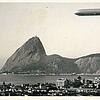Frau Richter, vor 150 Jahren wurde das Deutsche Reich gegründet. Das hat auch Baden oder Hohenzollern einschneidend verändert. Doch fragt man sich: Was gibt es zu feiern? Warum wenden wir uns zurück?
Das Deutsche Reich war ein vielschichtiger, sehr dynamischer Staat, der 1871 völlig anders aussah als 1914. Die Forschung der letzten Jahrzehnte hat gezeigt, dass es nach 1871 viel Aufbrüche gab, die man lange Zeit nicht beachtet hat. Es war der erste deutsche Nationalstaat. Wir erinnern uns 2021 an beides, also an die autoritäre Struktur dieses ersten Nationalstaates und an Emanzipatives, Fortschrittliches, was sich damals Bahn brach.

Ihre jüngsten Veröffentlichungen haben für viel Beachtung, auch Tumult gesorgt. Sie weisen darauf hin, dass gerade im Kaiserreich die Moderne in Ansätzen greifbar wird, dass es also mehr gab als nur Pickelhauben und Kasernenhof. Können Sie einige Beispiele nennen?
Das Parlament beispielsweise war wichtig und hat immer mehr an Einfluss gewonnen. Für viele wurde es nicht nur zunehmend zum Inbegriff der nationalen Einheit – Parlamentarismus und Nation waren ja in Deutschland eng verbunden. Es wurde auch zur entscheidenden Verfassungsinstanz, die Reden dort wurden reichsweit diskutiert. Die Jahrzehnte waren insgesamt von Optimismus geprägt, die Wissenschaft blühte auf, die Wirtschaft boomte. Die Zeit wird auch als die erste Globalisierung bezeichnet. Die Menschen damals haben das genau wahrgenommen. Und die meisten Aufbrüche finden sich international; aber auch die meisten schrecklichen Seiten: Antisemitismus etwa oder der Kolonialismus.
Wo sehen Sie besondere Fortschritte in dieser Zeit?
Bei den Frauen! Lange Zeit war deren Aufbruch unterschätzt. Doch eine ausgezeichnete Forschung zur Frauengeschichte zeigt seit längerem, wie selbstbewusst diese Frauen zunehmend vorgingen, aber auch wie selbstverständlich sie noch unterdrückt wurden. In der Zeit des Kaiserreichs wird in Deutschland wie in vielen anderen Ländern die Frauenbewegung zu einer Massenbewegung.
Stimmt das geflügelte Wort von „Kinder, Küche, Kirche“ als Sache der Frauen für diese Zeit?
Von einigen Ausnahmen wie der großartigen Hedwig Dohm, einer Schriftstellerin, abgesehen, glaubten die Menschen fest an zwei klar getrennte Geschlechterrollen. Viele Feministinnen nutzten das erstaunlicherweise als Argument: Weil Frauen ganz anders und besser und friedlicher und sozialer sind, sollten sie mehr Einfluss haben.

Das Frauenwahlrecht wurde erst nach dem Ende des Kaiserreichs eingeführt, das war 1919.
Das ist richtig. Auch hier liegt Deutschland im internationalen Trend. In der Zeit nach dem I. Weltkrieg gelang es in vielen Ländern den Frauen dieses Recht zu erkämpfen. Einige wenige Länder wie Finnland oder Neuseeland hatten das Frauenwahlrecht schon vor dem Weltkrieg. Andere erst später. Großbritannien gewährte das volle Wahlrecht erst 1928, Frankreich 1944 wählen und die Schweiz erst 1971. Immer wieder ist wichtig: Wenn wir das Kaiserreich bewerten, müssen wie den internationalen Kontext beachten: Konstitutionelle Monarchien waren in Europa damals die Regel, Republiken die Ausnahme.
Viele Historiker bezeichneten die Entwicklung des kaiserlichen Deutschland lange als „Sonderweg“ und meinten damit, dass es weit hinter dem Standard der westlichen Staaten zurückfalle. Ist diese These noch zu halten?
In der Forschung gilt diese These etwa seit den 1980er Jahren als veraltet. Allein, weil das theoretisch keinen Sinn ergibt: Was wäre dann der „normale“ Weg? Interessant ist, warum sich diese These so lange im öffentlichen Diskurs hält, in den Schulbüchern etwa oder in den Zeitungen. Ich denke, die These hatte viele wichtige Funktionen.
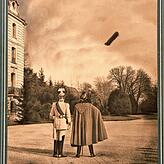
Schauen wir auf den damaligen Südwesten. Bis heute sind Straßen nach den Monarchen aus dem Haus Hohenzollern benannt, nach preußischen Generälen und natürlich nach Otto von Bismarck. Waren die Badener wirklich so begeistert?
Ursprünglich war die Skepsis in Baden und in Württemberg sehr groß. Beide haben sich dann allmählich ans Reich gewöhnt und sich zunehmend auch als Bürger und Bürgerinnen des Reichs gefühlt. Bei den Jüngeren ging es vermutlich schneller als bei den Älteren. Viele entwickelten eine doppelte Identität: Sie waren Badener und sie wurden begeisterte Deutsche.
Woher kommen die alten Vorbehalte dagegen? Hat das noch mit dem blutigen Niederschlagen der Revolution 1848 zwischen Konstanz, Lörrach und Rastatt zu tun?
Vermutlich schon. Die Preußen stießen auf viel Skepsis im Südwesten. Das hohenzollerische Königreich schien übermächtig und machte ja auch zwei Drittel des Kaiserreiches aus. Doch nicht zuletzt der Reichstag entfaltete eine einende Wirkung. In diesem Organ waren alle vertreten. Übrigens können Sie auch an den zahlreichen Bismarcktürmen und Bismarckgedenkstätten der Zeit sehen, dass sich doch ein beträchtlicher Teil die Bevölkerung mit dem neuen Staatswesen identifiziert hat. Bismarck galt als der Vater der Reichseinigung.
Vor dem Stadtpalais von in Stuttgart steht eine Bronzefigur, die den letzten württembergischen König in Zivil zeigt, wie er mit seinen zwei Hunden spazieren geht. Nun gibt es Pläne, das Denkmal in den hinteren Teil des Gartens zu verbannen – eine Art Abstellkammer. Halten Sie diesen Umgang für angemessen?
Ich finde es richtig, wenn wir mit Denkmälern kreativ umgehen. Die Dinge sind im Wandel. Demokratien sind flexibel, sie nehmen Neues auf. Ich halte insgesamt bei den Denkmaldebatten die Debatten selbst für den interessantesten Teil: dass sich die Bevölkerung darüber Gedanken macht, wer sie ist und an wen sie erinnern will. Bei Wilhelm II. mit seinen Hündchen gibt es bestimmt verschiedene Lösungsmöglichkeiten. Es könnte auch eine Informationstafel geben, in der auf die problematischen Seiten des Monarchen hingewiesen wird.
Ein Argument für die Verbannung lautet: König Wilhelm war ein Militarist, ein autoritärer Mensch. Wie viel hatten diese Monarchen wirklich zu sagen? Ein König von Württemberg oder ein Großherzog Friedrich von Baden? Lassen sie sich mit den heutigen Ministerpräsidenten vergleichen?
Mit einem modernen Ministerpräsidenten wie zum Beispiel Winfried Kretschmann hatten sie wenig gemein, weil die heutigen Länderregierungschefs demokratisch legitimiert sind. Doch verfügten sie über beträchtlichen Einfluss. Sie waren mehr als gekrönte Repräsentanten ihres jeweiligen Landes.
Großherzog Friedrich I. war enorm populär. Ist das der Grund, dass man das badische Wappen mit Krone bis heute häufig sieht?
Viele Hausbesitzer haben das Wappen übernommen, weil es für manche ein Merkmal Badens geworden ist, ein Stück Folklore. Das heißt wohl in den wenigsten Fällen, dass sie die Monarchie zurückhaben wollen. Diese Gefahr sehe ich nicht. Alle Umfragen zeigen, dass es in der Bevölkerung eine sehr große Akzeptanz der Demokratie gibt, aber keine Sehnsucht nach der Monarchie.
Ihre Studien erreichen viele Leser, Sie zählen inzwischen zu den bekanntesten Gesichtern Ihrer Zunft. Von einigen Kollegen werden Sie hart kritisiert, sie werfen Ihnen vor, dass Sie zu populär und zu leicht lesbar schreiben. Wie kann man sich nur daran stoßen?
Ich habe viel Unterstützung erfahren von Kollegen und Kolleginnen, die es wichtig finden, dass eine schwierige Materie verständlich aufbereitet wird. Interessanterweise schreiben mir gerade Kolleginnen und Kollegen aus dem angelsächsischen Raum, dass sie die Kritik nicht verstehen.
Täuscht der Eindruck: In Ihrer Disziplin tummeln sich nur wenig Frauen?
Wie in fast jeden Fach, ist die große Mehrheit auf den Professuren männlich. Aber es tut sich einiges, es gibt inzwischen auch viele Professorinnen. Was ganz bestimmt noch besser werden könnte: Die Forschungen zur Frauengeschichte, die viele ausgezeichnete Kolleginnen seit Jahrzehnten vorlegen, wird von der sogenannten „allgemeinen Geschichte“ oft zu wenig zur Kenntnis genommen. Gerade für das Kaiserreich war der Aufbruch der Frauen aber so entscheidend, dass er sich kaum als Randerscheinung oder in einem Frauen-Zusatz-Kapitel abhandeln lässt.
Bildet die Frühzeit der Frauenbewegung einen Ihrer Schwerpunkte?
Die Frauengeschichte ist wichtig für mich, überhaupt der Forschungsschwerpunkt der Geschlechtergeschichte. Warum etwa glaubte die überwältigende Mehrheit der Menschen im 19. Jahrhundert, dass politische Partizipation männlich ist und nichts für Frauen? Und warum kam in den Jahrzehnten um 1900 die alte Geschlechterordnung von der Minderwertigkeit der Frauen so stark ins Wanken wie wohl noch nie zuvor?
Verstehen Sie sich als Feministin?
Ja, unbedingt! Ich bin für die Gleichberechtigung aller; eine alte Forderung, die im Kaiserreich neuen Aufschwung erhielt, aber auch schlimme Niederlagen erlitt.