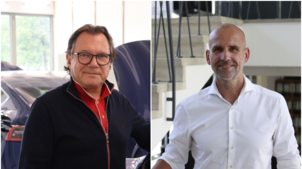Während die ideologisch getriebenen unter den Politikern den menschgemachten Klimawandel weiterhin abstreiten, ist er für die Vertreter der Fakten basierten Wissenschaft eine bewiesene Tatsache. Wer am Bodensee wohnt, findet die Beweise direkt vor der Haustür. Das mit rund 50 Kubikkilometern Volumen drittgrößte Gewässer Europas erweist sich als empfindliches Messinstrument für die klimatischen Veränderungen. Höhere Wasserstände im Winter und niedrigere im Sommer zeugen davon, ebenso die Besiedelung durch nicht heimischen Pflanzen und Tiere. Das größte Problem aber ist, dass durch die stetige Erwärmung des Sees nicht mehr genügend Sauerstoff in die Tiefe transportiert wird.

Durchschnittstemperatur des Sees steigt kontinuierlich
Die klimatische Erwärmung spiegelt sich direkt in den Temperaturveränderungen des Oberflächenwassers wider. In der Messperiode von 1990 bis 2015 war der Bodensee um 0,9 Grad Celsius wärmer als im Vergleichszeitraum von 1962 bis 1989. Diese Zahlen stammen aus dem Projekt Klimawandel am Bodensee (KlimBo), das die Internationale Gewässerschutzkommission für den Bodensee (IGKB) vor zehn Jahren auf den Weg gebracht hatte. Koordiniert vom Institut für Seenforschung (ISF) in Langenargen, untersuchten deutsche und Schweizer Wissenschaftler ab 2011, welche Auswirkungen der Klimawandel auf den Bodensee und auf seine Nutzung als Trinkwasserspeicher hat.
Ergebnisse einer Untersuchung füllen viele hundert Seiten
Nach vier Jahren füllten die Ergebnisse vielen hundert Seiten: Die Erwärmung hat weitreichende Folgen, deren Größenordnung von den weiteren klimatischen Veränderungen abhängt. Diese Entwicklungen wurden innerhalb KlimBo in Modellen bis in das Jahr 2085 simuliert. Für die vergangenen fünf Jahre steht nun fest, dass die Wissenschaftler hinter ihren Zukunftsprojektionen jährlich einen Haken machen konnten. Sie bewahrheiten sich.
„Ja, der Trend hat sich fortgesetzt“, referiert Bernd Wahl vom Langenargener ISF auf aktuelle SÜDKURIER-Anfrage über die steigende Erwärmung des Oberflächenwassers. Für den Zeitraum 1990 bis 2018 beträgt sie im Vergleich zur Periode 1962 bis 1989 aktuell 1,2 Grad Celsius, ergebe sich aus den Daten des IGKB-Monitorings.
„Klimaprojektionen bestätigen sich“
„Wir haben in den letzten Jahren weiterhin ‚wärmste Jahre‘ oder ‚wärmste Monate‘ zu verzeichnen, sodass in der Tendenz die verwendeten Klimaprojektionen bestätigt sind“, sagt Wahl. „Auch die im Projekt KlimBo durch Modelle nachgebildeten Einflüsse auf die winterlichen vertikalen Durchmischungen finden sich in den realen Beobachtungen wieder“, fasst der ISF-Wissenschaftler weiter zusammen. „Das heißt, wir hatten eine Serie von Jahren mit unzureichendem Tiefenwasseraustausch und damit absinkenden Sauerstoffkonzentrationen über Grund.“
Flachwasserzonen werden wichtiger
„Erst 2018 kam es wieder zu einer guten Durchmischung“, erläutert Wahl weiter. „Hier dürfte der in den Modellsimulationen dargestellte Effekt des ‚Differential Cooling‘ eine maßgebliche Rolle gespielt haben: Die Bregenzer Bucht war schneller ausgekühlt und war damit eine Quelle schweren Wassers für den Tiefenwasseraustausch des Bodensee-Hauptbeckens.“ Unter „Differential Cooling“ versteht der Fachmann, wenn sich das Wasser in Buchten und Flachwasserzonen schneller als in tiefen Regionen auf vier Grad abkühlt, damit seine größte Dichte erreicht und dann in Richtung Seemitte zum Grund fließt. Diesem Effekt kommt laut KlimBo künftig wachsende Bedeutung zu, wenn die winterliche Abkühlung nicht ausreicht, um auch das Oberflächenwasser in tiefen Regionen abzukühlen.

Obere Wasserschichten kühlen im Winter nur unzureichend aus
Ungeachtet der Durchmischungen 2018 ist die Einschätzung, die Bernd Wahl als ISF-Sprecher auch für namens der Landesanstalt für Umwelt Baden-Württemberg (LUBW) abgibt, eindeutig: „Tendenziell hat sich die Gefahr eines mangelnden Sauerstoffaustauschs erhöht. Die Ursachen sind die unzureichende Auskühlung der oberen Wasserschichten im Winter.“
Wie fit ist der Bodensee für den Klimawandel?
Das 2015 beendete Projekt KlimBo stellte die Frage: Wie fit ist der Bodensee für den Klimawandel? „Eine abschließenden Antwort liegt nicht vor“, beantwortet sie Bernd Wahl vom ISF heute, knapp fünf Jahre nach Abschluss des Projektes. Aber es sei durchaus einiges an Erkenntnisgewinn hinzugekommen. „Wir wissen, dass sich die winterlichen vertikalen Mischungsverhältnisse mit der zunehmenden Erwärmung verändern und sich damit das Risiko erhöht, dass es im Tiefenwasser zu Sauerstoffdefiziten kommt, mit nachteiligen Einflüssen auf die dort lebenden Organismen und die chemischen und mikrobiologischen Stoffumsätze.“
Aktuelles Forschungsprojekt untersucht, wie widerstandsfähig der See ist
Aufgrund der Nährstoffverhältnisse, die nach Jahrzehnten überhöhter Werte wieder auf ein naturnahes Niveau zurückgegangen seien, beschreibt Wahl, sei auch der Sauerstoffverbrauch gering, der mit den mikrobiellen Abbauprozessen im Tiefenwasser einhergehe. „Sodass der Bodensee diesbezüglich gute Voraussetzungen für den Klimawandel mit sich bringt.“ Es gebe jedoch viele Bereiche, in denen weitere Forschung erforderlich seien. Momentan befasse sich das Interreg-geförderte Forschungsprojekt Seewandel mit der Fragestellung, wie resilient – widerstandfähig – der Bodensee sei, und damit auch damit, wie er auf Einflüsse des Klimawandels reagiert.