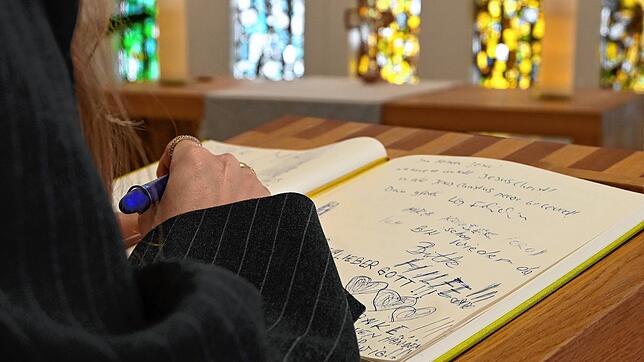Sie kommen bei den schweren Fällen zusammen. Dann, wenn ein Unfall die Lebensqualität eines Menschen unwiederbringlich verschlechtert hat. Dann, wenn jemand nicht mehr leben will. Dann, wenn ein Patient nicht mehr selbst entscheiden kann, wie es weiter geht. Es sind Situationen, in denen die Therapie bloße Symptombehandlung überschreitet. Unter diesen Umständen ist am Helios-Spital in Überlingen der Arbeitskreis Ethik gefragt.
Konferieren über Ausnahmesituationen
Die Umstände treten jedoch nur selten auf. Zwischen 2017 und diesem Jahr beriet der Arbeitskreis zwischen einem und fünf Fällen pro Jahr. Dann beraten sie und die anderen, meist ehrenamtlichen Teilnehmer im Austausch mit dem Patienten, dessen Angehörigen oder Betreuern, mit dem behandelnden Arzt und dem Pflegepersonal über die Weiterbehandlung, beschreibt Vorsitzende Elsie Fickenscher. Ab 2001 war sie selbst als Ärztin am Helios-Spital tätig. Seit 2015 ist die 69-jährige Internistin im Ruhestand.

2008 ging der Impuls vom Klinikpersonal aus, den Arbeitskreis in seiner beratenden Funktion zu gründen. Seine Kernaufgabe begreifen seine Mitglieder darin, „die Autonomie der Patienten zu wahren, über Behandlungsoptionen aufzuklären und darüber die Entscheidungsfindung zu unterstützen“, erklärt Ortwin Engel-Klemm, der als Klinikseelsorger ebenfalls dem Arbeitskreis angehört.
Widersprüche auflösen
„Im Krankenhaus erleben wir den Menschen nur, wenn es ihm schlecht geht“, sagt Fickenscher. Dieser Ausschnitt ist bei den Entscheidungen des Arbeitskreises Ethik unzureichend, findet sie. Für einen ganzheitlichen Blick auf den Patienten seien viele Perspektiven notwendig. Deshalb kommen bei den Fallbesprechungen Angehörige, Ärzte, Physiotherapeuten, Sozialdienst, Pflegepersonal und Seelsorger zusammen. Im Mittelpunkt der Beurteilung stehen vier Aspekte: nicht schaden, Wohltun, Autonomie und Gerechtigkeit.

Fickenscher erzählt aus der Praxis: Es ging um eine Schlaganfallpatientin, sie konnte kaum mehr sprechen und nur noch schlecht schlucken. Soll also eine Magensonde gelegt werden, um sie zu ernähren? Im ersten Zusammentreffen kam das Gremium zu dem Schluss, die künstliche Ernährung zu befürworten, doch es fühlte sich nicht richtig an, erzählt die Arbeitskreis-Vorsitzende. „Wir hatten das Gefühl, der Patientin nichts Gutes zu tun.“
Sie habe gesagt, sie wolle nicht sterben, aber auch keine Sonde, erinnert sich die Ärztin. Diesen Widerspruch galt es aufzulösen. „Über die Sonde hätte sie mehr Nahrung aufnehmen können“, erklärt sie, wodurch sie besser zu Kräften hätte kommen können. Doch aufgrund des Patientenwunsches wurde letztlich entschieden, Essen mit dem Löffel anzureichen.
Ethische Entscheidungshilfe
Die in der Regel einstündigen Fallbesprechungen beschreibt die ehemalige Ärztin als moderierte Gespräche. Ausgangspunkt sei, dass jemand Bedarf daran anmeldet. Am Ende der Fallbesprechung steht das Therapieziel. Eine Empfehlung – die Entscheidung über die weitere Behandlung trifft der Arzt. Er trägt die Verantwortung. Doch mit der Unterstützung des Arbeitskreises ist er mit der Entscheidungsfindung nicht alleingelassen.
Ethische Entscheidungen stehen im Krankenhaus-Alltag ständig an. „Regelmäßig kommt es in einer Nachtschicht vor, dass es in drei Zimmern gleichzeitig klingelt“, schildert Fickenscher. Der Ethik-Kreis bespricht Ausnahmesituationen, aber für seine Arbeit sind sie die Regel. Er zeigt, wie nah Leben und Tod beieinanderliegen. Laut Statut sind 13 stimmberechtigte Mitglieder vorgesehen, sagt die Vorsitzende. Das seien die Kernteilnehmer. Auch nicht Stimmberechtigte dürfen mitmachen, die Besetzung wechsle ohnehin häufig. Einmal im Monat kommt das Gremium zusammen, um akute Fälle zu besprechen, Fortbildungen zu Palliativberatung anzubieten oder Stationsbesuche zu planen.
Was den Menschen am Leben hält
Für die Arbeit des Gremiums sind die Klinikseelsorger unerlässlich. „Wir suchen nach dem, was die Menschen am Leben hält“, erzählt Engel-Klemm. Am häufigsten wird die Familie genannt, aber auch der Glaube, die Natur oder schlicht ein Ziel zu haben, berichtet der 58-Jährige.

Im seelischen Beistand verschwimmen Ethik und Seelsorge. Die Krankenhaus-Seelsorger begleiten die Menschen über eine Schwelle. Über die Schwelle zwischen Leben und Tod, die Schwelle zwischen Alltag und Glaube, zwischen Physik und Metaphysik. In ihrer Arbeit verschmelzen Ethik und Seelsorge. „Wir vermitteln den Menschen, man darf sterben“, sagt Engel-Klemm, der auch die Überlinger Hospizgruppe leitet.

Gespräche zwischen Leben und Tod
Die Klinikseelsorger begleiten die Patienten in ihrer Lebenssituation und machen ihnen auch geistliche Angebote, erklärt Ortwin Engel-Klemm. „Wir wollen einen Moment des Innehaltens anbieten“, sagt Pastoralreferent Martin Blume. Gemeinsam mit Religionspädagogen Ortwin Engel-Klemm ist er Krankenhaus-Seelsorger. Bei den Gesprächen gehe es meist um das Leben, nicht um das Leid, beschreibt Blume.

Dass sie als kirchliche Vertreter Beistand leisten und nicht als Psychologen, halten sie für einen Vorteil. Sie bearbeiten ein breiteres Feld und orientieren sich an der existenziellen Situation des Menschen. „Was Seelsorge mehr hat, ist die Botschaft ‚Gott liebt dich‘, du bist wertvoll“, beschreibt Blume. Da diese Botschaft nicht nur Patienten vorbehalten ist, stehen sie auch dem Personal zur Verfügung. Alle drei Monate besucht Elsie Fickenscher die Beschäftigten auf der Intensiv-Station. Die Schicksale der Patienten hinterlassen dort ihre Spuren. „Es hat eigentlich immer jemand etwas zu erzählen“, sagt Fickenscher. So beginnt das Wirken des Arbeitskreises Ethik bei den Patienten, schließt sich beim Personal an und umfasst den Menschen.