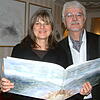Amig hat, auch wenn der Gedanke nahe liegt, nichts mit einer Amme zu tun. Amig ist Mundart und steht für ehemals. So, wie die Mundart gelegentlich als ehemalig, als von gestern, bezeichnet wird. Aber ist sie das? Ist sie wirklich eine gestrige Sprache, die sich auf dem absteigenden Ast befindet, nur weil das Hochdeutsch unseren Alltag bestimmt? Noch gehört die gesprochene Mundart zum Alltag, weiß der im Wiesental heimische Schriftsteller Markus Manfred Jung, „besonders entlang der Schweizer Grenze und in eher ländlichen Gebieten“. Natürlich gleichen sich Wortschatz und auch Grammatik mehr und mehr dem Standarddeutschen an, fährt er fort.
Andererseits würde dadurch, dass junge Menschen via Medienkonsum selbstverständlich Standarddeutsch können, der Minderwertigkeitskomplex verschwinden, den früher die Nur-Dialektsprecher hatten, sobald sie ihre gewohnte Sprachumgebung verlassen mussten. Die Jungen heute, ist er überzeugt, könnten mit Selbstbewusstsein wieder Dialekt sprechen. Jugendliche sind heute meist dreisprachig: Deutsch, Englisch, Muttersprache (Italienisch, Russisch, Serbokroatisch, Alemannisch, Türkisch) – und Jung meint das nicht ironisch.
Dialekt befindet sich im Rückgang
Josef Klein, Vorstandsmitglied des VBE (Verband Bildung und Erziehung) im Schulkreis Lörrach-Waldshut, hingegen sieht den Dialekt im Rückgang begriffen – auch deshalb, „weil die Bevölkerung mobiler ist und eine erkleckliche Anzahl nicht-alemannisch sprechender Menschen zuziehen“. Äußeres Kennzeichen für den Rückgang scheint ihm, „dass man alemannische Muetersprochgesellschaften braucht, um den Dialekt ins Hörfeld zu rücken“.
Klein weiter: Gut bestellt wäre es, wenn man weder Vereine bräuchte noch festliche Anlässe, sondern wenn der Dialekt „eifach wie amig zum Alldag ghöre würdi“. So, wie in der deutschsprachigen Schweiz. Dort ist Schwizerdütsch mit all seinen kantonalen Nuancen generationenübergreifend die bestimmende Umgangssprache, Hochdeutsch ist Unterrichtsfach an den Schulen und wird nur im Schriftverkehr verwendet.
Einsatz für Erhalt der Mundart
Hierzulande gibt es viele Menschen, die sich für den Erhalt und die Lebendigkeit der Mundart einsetzen, „weil sie ihre Bild- und Klangmächtigkeit schätzen und weil es eben einfach ihre Erst-, ihre Muttersprache ist“, berichtet Markus Manfred Jung. Schwieriger sei es bei der jetzigen Elterngeneration, die im Moment keinen Nutzen darin sieht, in der Erziehung die Mundart zu verwenden, da die meisten Kindergärten und die Schulen sowieso „bildungsaffines Standarddeutsch“ pflegen, aus meist falsch verstandener Sorge um die Zukunft der ihnen anvertrauten Kinder
Dabei hätten die meisten Kindergehirne „ein großes, kreatives Sprachpotenzial, das für zwei oder drei Varianten empfänglich ist“, weiß er. Jung hat beobachtet – er war selbst als Lehrer tätig – wie in der Kultuspolitik in Baden-Württemberg der Dialekt in den vergangenen 50 Jahren, im Gegensatz zum Beispiel zu Bayern, eine nebensächliche Rolle spielt. Zeitweise war er sogar aus den Lehrplänen verbannt.
Mundart im Unterricht
Einige wenige Lehrer sowie die Mundartverbände haben gegen die „Bildungsignoranz“ angekämpft, sodass es jetzt zumindest das Projekt www.mundart-in-der-schule.de gibt, wo Interessierte sich erfahrene Mundartautoren sowie Liedermacher in den Unterricht holen können, was das Land finanziert. Außerdem gibt es alle drei Jahre den Wettbewerb „wunderfitz und naseweis“, wo Klassen für ein Mundartprojekt ausgezeichnet werden. Jung: „Im Moment scheint, dank des starken Einsatzes für Dialekt von Ministerpräsident Kretschmann, auch da ein zögerliches Umdenken in Richtung Einbindung in den Unterricht stattzufinden.“
Aber wie wäre es mit der Mundart als Schulfach? „Jo wägerli“, meint Klein, „noch eine Fremdsprache mehr?“ Wo zu Hause Alemannisch gesprochen wird, dort können es die Kinder in der Regel auch, ist er überzeugt. Und wo die Anwendung fehlt, da wird es nichts, auch wenn es unterrichtet wird. Klein: „Ich bin schon sehr froh, wenn hier und da ein Projekt in alemannischer Sprache in der Schule durchgeführt würde. Aber aus meiner Erfahrung gibt es da vereinzelt Widerstände von Personen aus Trans-Alemannia dagegen.“ Und überhaupt: „In der Schule muss man heutzutage froh sein, wenn jemand unfallfrei Hochdeutsch sprechen kann. Wer den Genitiv nicht ehrt, ist des Dativs nicht wert.“
Dialekt ist auch für Künstler wichtig
Alemannisch, Mundart oder Dialekt ist auch für Künstler bedeutsam. Johann Peter Hebels „Alemannischen Gedichte“ mögen am Anfang stehen. Aber etliche Autoren nach ihm haben ihre Texte – Gedichte, Lieder, Essays, Schauspiele – in ihrer Muttersprache verfasst.
Einer von ihnen war Manfred Marquardt, ein Naturpoet, Dichter und Lehrer aus Lörrach. Sein Naturempfinden hat er in berührenden alemannischen Versen ausgedrückt. Vor allem: Er trat auch als Warner gegen die um sich greifende Umweltzerstörung an. Roland Kroell, Autor und Musiker aus Laufenburg, war mit Marquardt eng befreundet und hatte ihn angeregt, seine Gedichte zu veröffentlichen. Seine Gedichte und Sprüche wirkten auf ihn wie „alemannische Mantras“, sagt Kröll, der Marquardt so beschreibt: „Ihn schmerzte es, wie immer mehr Waldwege angelegt wurden, um der modernen Holzwirtschaft der radikalen Abholzungen Tür und Tor zu öffnen, auf Kosten der Natur.“ Manfred Marquardt starb, bevor es ein offizielles Waldsterben gab. Der Hotzenwald und die Hochmoore um Ibach waren seine zweite Heimat. Dort verbrachte er ein Großteil seiner Freizeit, dort kannte er jeden Quadratmeter. Von seinen Freunden liebevoll als „Herr der sieben Moore“ genannt, war er eine Art selbsternannter Naturwart. Was Kröll und Marquardt auch verband: Geschichte und Schicksal der Salpeterer. Das Salpeterertum, so ihre Überzeugung, war auch geistiger Widerstand gegen Sachzwänge und die heimlich um sich greifende Zerstörung des Hotzenwaldes als Heimat.