„Ich will nicht abgetrieben werden, sondern auf der Welt bleiben.“ Bei diesem Satz wurde es kurz still im Fernsehstudio. Angela Merkel musste im Wahlkampf viele nüchterne Fragen zu Abgaswerten und Obergrenzen beantworten. Und dann kam eine 18-Jährige mit Down-Syndrom und stellte eine Frage, die den Kern menschlicher Ethik trifft. Wer darf leben?
In Deutschland kommen viele Babys nicht zur Welt, weil Eltern die Schwangerschaften aufgrund von vorgeburtlichen Tests abbrechen lassen. Wie viele, ist statistisch nicht zuverlässig erfasst. Die vorgeburtlichen Tests jedenfalls werden mehr. Weil immer mehr Schwangere über 35 Jahre alt sind – aber auch, weil immer mehr Ärzte ihren Patientinnen zu den speziellen Tests über die Standarduntersuchungen hinaus raten. Einfache Bluttests, wie der Konstanzer Firma Lifecodexx, geben Auskunft, ob das Kind zum Beispiel das Down-Syndrom hat. Sie können beruhigende Gewissheit über manche Behinderungen bringen. Oder eine Frage, an der Psychen und Partnerschaften zerbrechen können: Behalten wir das Kind?
I. Robin
„An diesem einen Tag hätte ich gesagt: Nein“, sagt Marion Bahm. Die Wucht dieses Satzes ist ihr bewusst, aber er zeigt, welche Wucht sie an diesem einen Tag vor vier Jahren traf. Robin ist gerade zwei Tage alt, als der Arzt in das Zimmer der Frauenklinik Konstanz kommt und nach dem Mutterpass und Voruntersuchungen fragt. Marion Bahm wird unsicher. Ist alles in Ordnung? „Ich komme gleich wieder“, antwortet der Arzt. Es vergeht eine Stunde, die längste ihres Lebens. Dann die Worte des Arztes: „Es könnte sein, dass Ihr Kind das Down-Syndrom hat“.
Es müsse aber noch ein Test gemacht werden. Zwei Tage war Robin zu diesem Zeitpunkt am Leben, als Marion Bahm dachte, ihres sei zu Ende. Zwei Tage war er ihr ganz normales Kind, jetzt stellte sie sich einen Menschen vor, der nicht laufen, nicht sprechen kann und für immer auf Hilfe und Pflege angewiesen sein wird. Zwei weitere Tage muss sie warten, bis das Testergebnis da ist. Marion Bahm schaut Robin immer wieder an, wie er nach dem Kaiserschnitt im Wärmebettchen liegt. Seine Finger, seinen Mund, seine Augen. Nichts sah unnormal aus.
Über das Thema Down Syndrom hatte Marion Bahm während der Schwangerschaft viel gesprochen. „Vielleicht hat mein Körper da schon etwas gemerkt“. Pränatale Tests hat sie dennoch nicht gemacht, ganz bewusst. Warum auch? Schon ihre Einstellung zum Leben würde ihr keine Entscheidung dagegen erlauben. Vor Robin hatte Marion Bahm ein Mädchen verloren. Die Nabelschnur hatte sich um den Hals gewickelt. „Ich hätte dieses Kind gerne bei uns gehabt, egal, was sie hat. Hauptsache, sie lebt.“
Robin lebte. Zwei Tage vergingen auf der Neugeborenenstation. Während nebenan Familien lachten, weinte Marion Bahm stundenlang. In der Theorie war vieles so klar gewesen, alles gut, irgendwie, das werden wir schon schaffen. Und dann liegt man plötzlich am Boden und weiß nicht, wie es weitergehen soll. Man wünscht seinem Kind doch nur das Allerbeste, den leichten Weg, die schönsten Aussichten. Wie soll das mit einer Behinderung funktionieren?
Der erste Moment ohne Verzweiflung
Nach zwei Tagen ist das Testergebnis da. Positiv. „Wissen Sie, so ein Kind kann man auch lieb haben“, habe eine Frau damals zu ihr gesagt. Ein Satz, den sie noch heute kaum fassen kann, der aber dennoch etwas auslöst. „Ich wollte ihn jetzt erst recht beschützen.“ Marion Bahm nimmt ihren Sohn aus dem Wärmebettchen, zu sich unter die Decke und schaltet den Fernseher an. Der erste Moment ohne Verzweiflung. In ihrem Arm liegt Robin, kein behindertes Kind.
Ein Jahr hat Marion Bahm Schwierigkeiten, voll zur Behinderung von Robin zu stehen. Auf Whatsapp achtet sie darauf, kein Bild von ihm zu zeigen, auf dem er die Zunge draußen hat. Mit anderen Müttern älterer behinderter Kinder will sie keinen Kontakt aufbauen. Keine Kontaktgruppen, keine Lebenshilfe-Stammtische. „Ich wollte nicht dazugehören. Wenn ich da jetzt hingehe, bin ich die Mutter eines behinderten Kindes.“ Heute sind sie die Familie mit dem fröhlichen Robin, die viele kennen. „Robin sagt in der Stadt jedem Fünften Hallo“, erzählt Marion Bahm und lächelt. Wie schon so manche verbissene Oma plötzlich lächelte, als Robin grüßte.
Vier Jahre ist er jetzt alt. Aus dem Verstecken ist Stolz geworden. Aus der Ablehnung, sich mit dem Thema Down-Syndrom zu beschäftigen, ein großes Interesse. „Robin stellt sich mit nichts in Frage, daraus können wir wahnsinnig viel lernen. Ich hinterfrage mich zudem viel öfter, ob ich nicht gerade in Vorurteilen denke. Die hat ja jeder, aber Robin lässt mich mehr darüber reflektieren. Er hat nie unbegründet schlechte Laune.“ Familie Bahm ist an den Herausforderungen so gewachsen, dass es keine mehr zu sein scheinen. Weil vieles Alltag geworden ist, aber auch, weil Marion Bahm ihr Bild von einem Kind mit Behinderung immer wieder korrigiert. „Ich unterschätze meinen Sohn ständig.“
Irgendwann ein eigenständiges Leben
Als Robin zwei Jahre alt war, robbte er in einen inklusiven Platz in einer Krippe im Paradies rein. Nach einem Monat konnte er laufen. Noch kann er nicht in ganzen Sätzen sprechen, aber vieles über Gebärdensprache vermitteln. Auch Janek, der ältere Sohn von Marion Bahm, kann schon gut mit seinem Bruder Robin in Gebärdensprache kommunizieren, übt zum Beispiel mit einem Plakat, das bei der Familie im Flur hängt.

Es gibt spezielle Spiele wie die App mathildr, mit denen Down-Syndrom-Kinder rechnen lernen können. Es dauert nur länger und funktioniert anders als bei anderen Kindern, die Forschung ist noch längst nicht abgeschlossen. „Natürlich hört es nach hinten irgendwann auf“, weiß auch Marion Bahm.
Robin wird vielleicht kein Abi oder Studium machen, aber dennoch irgendwann ein eigenständiges Leben in seiner eigenen Wohung oder Wohngemeinschaft führen, da ist sich Marion Bahm sicher. „Natürlich wird er immer Hilfe brauchen, bei den Finanzen beispielsweise. Aber in irgendetwas sucht doch jeder Mensch Hilfe. Er braucht eben ein bisschen mehr.“
Marion Bahm beschönigt nichts, erzählt auch davon, wie viel Aufmerksamkeit Robin ihr abverlangt, dass sie weiter Windeln wechselt, dass sie auch von Familien oder Paaren gehört hat, die daran zerbrochen sind. Eines aber ist ihr wichtig: „Ich fand den Satz immer selbst doof, aber dieses Kind ist eine totale Bereicherung für uns. Wir maßen uns an, zu sagen: Menschen mit Down-Syndrom haben ein minderwertigeres Leben als wir. Wo setzen wir da eigentlich die Norm?“
Vor vier Jahren gab es einen Moment, in dem sie sich dachte: Ich will dieses Kind nicht. Marion Bahm hat sich anders entschieden, auch, weil sie nach der Geburt zwei unbeschwerte Tage mit Robin hatte. „In der zehnten Woche, wenn man vor solch eine Entscheidung gestellt wird, hat man noch nicht diese Bindung und entscheidet aufgrund der Panik und des Drucks oft anders“, sagt Marion Bahm.
II. Pränataldiagnostik
In der zehnten Schwangerschaftswoche ist der Embryo zehn bis 15 Gramm schwer. Das Herz ist fast vollkommen entwickelt, die Nieren wandern an ihren Platz, die Lunge und der Magen-Darm-Trakt wachsen weiter. Ab diesem Zeitpunkt können erste pränatale Zusatzuntersuchungen feststellen, ob das Kind das Down-Syndrom hat. Inzwischen gehören für viele Frauen die speziellen Untersuchungen der Pränataldiagnostik dazu, die über die regulären, im Mutterpass vorgesehenen Vorsorgeuntersuchungen hinausgehen. Mit ihnen wird gezielt nach Hinweisen auf mögliche Fehlbildungen und Entwicklungsstörungen, Chromosomen-Abweichungen und erblich bedingte Erkrankungen beim ungeborenen Kind gesucht.
Zehn Prozent machen den Bluttest
Das Angebot der möglichen Untersuchungen ist groß: Es gibt Ultraschalluntersuchungen, wie zum Beispiel das 1.Trimester-Screening mit Nackenfaltenmessung oder das Organscreening, nicht-invasive Bluttests wie den Praenatest und invasive Eingriffe wie die Plazenta-Punktion, die Fruchtwasseruntersuchung oder die Nabelschnur-Punktion, erklärt Marcus Nauth. Er ist Frauenarzt und spezialisiert auf pränatale Diagnostik. Neben den Standarduntersuchungen bietet er auch die Zusatzuntersuchungen an.
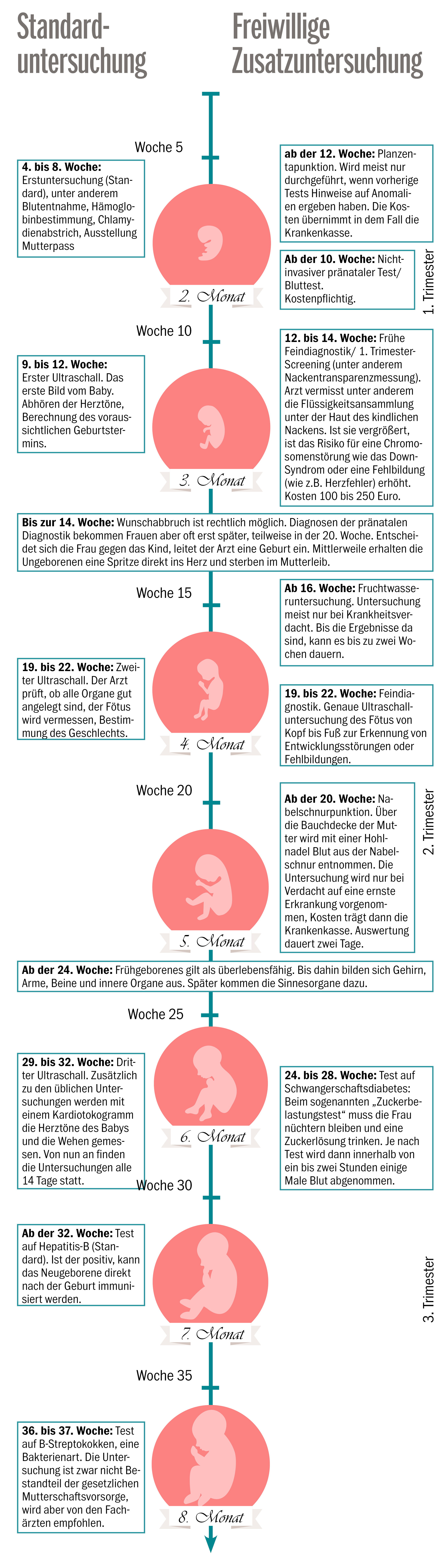
Für die Grafik im Vollformat hier klicken
Mit seinen Patientinnen bespricht Marcus Nauth vorab, ob und welche Untersuchung sinnvoll ist, und klärt über die Möglichkeiten und Grenzen der pränatalen Diagnostik auf. Etwa zehn Prozent seiner Patientinnen wünschten den Bluttest, Nauth empfehle aber prinzipiell davor die frühe Ultraschall-Feindiagnostik.
Ein weitaus größerer Teil möglicher Störungen und Fehlbildungen könne dabei bereits erkannt werden – aber auch diese kostet in der Regel. „Das sollte eben nicht sein“, sagt Nauth. „Pränatale Untersuchungen sollten keine Frage des sozialen Status sein.“ In den vergangenen Jahren hätten sich die Untersuchungsmethoden stetig verbessert – vor allem sind sie risikoärmer geworden, was Fehlgeburten betrifft. Nauth schätzt, dass in Zukunft noch mehr Erbkrankheiten über einen einfachen Bluttest erkennbar sind.
Selektiver Schwangerschaftsabbruch ist ein Tabuthema
Keinen dieser Tests muss eine Frau machen. Es gibt ein Recht auf Nichtwissen. Entscheidet man sich dafür, sollte man sich vorher bewusst sein, wie man später mit dem Ergebnis umgeht, sagt Sahera Semaan. Sie ist Ärztin in der Konstanzer Beratungsstelle von Pro Familia und berät Frauen kostenlos, wenn gewünscht anonym und finanziell unabhängig, betont sie. Das Auswählen und Abwägen zwischen verschiedenen Varianten beunruhige viele Frauen, trotzdem berät sie nur wenige Fälle – und dann vor allem, wenn das Ergebnis positiv ist. Semaan würde sich wünschen, dass die Frauen früher zu ihr kommen.
Wenn sie überhaupt kommen. Selektiver Schwangerschaftsabbruch ist ein tabuisiertes Thema, vor allem in Deutschland. Dabei trifft es immer mehr werdende Eltern. Frauen werden später schwanger, die Wahrscheinlichkeit für Veränderungen am Erbgut steigt – genauso wie die Ansprüche an die Elternschaft. „Viele Paare haben nur noch ein Kind, da muss alles optimal laufen. Das erhöht bei Vielen den Druck und den Stress in der Schwangerschaft. Unserer Gesellschaft würde es guttun, mit dem Thema Schwangerschaft wieder unbeschwerter, bejahender umzugehen", sagt Doris Wilke, die Leiterin von Pro Familia Konstanz.
III. Lifecodexx
Seit mehr als fünf Jahren ist der Praenatest der Konstanzer Firma Lifecodexx auf dem Markt, seither hat das Unternehmen nach eigenen Angaben 34 Millionen Euro Umsatz gemacht. In 50 Ländern der Welt wird der Test angeboten. Jetzt wolle man versuchen, die großen Märkte in den USA und Russland anzugreifen, erklärt Lifecodexx-Vorstand Michael Lutz. Der Test ist deshalb beliebt, weil er ungefährlicher ist als die bisher eingesetzte Fruchtwasseruntersuchung. „Über 98 Prozent der bislang durchgeführten Analysen ergaben ein unauffälliges Testergebnis“, sagt Elke Decker, Pressesprecherin von Lifecodexx in einem Besprechungszimmer in dem Gebäude in Stromeyersdorf. Drei Etagen tiefer befindet sich das Labor, in dem die Blutproben analysiert werden.

„Frauen haben das Recht auf informationelle Selbstbestimmung, auch für Untersuchungen im Rahmen einer Schwangerschaft“, sagt Wera Hofmann, die medizinisch-wissenschaftliche Leiterin von Lifecodexx. Wir alle sind überzeugt vom Nutzen dieser nicht invasiven Untersuchung, aber letztlich entscheidet die Patientin nach einem Aufklärungsgespräch mit ihrem Arzt.“ Was aber ist mit denen, die nicht überzeugt sind, die nicht wissen wollen? Werden Menschen mit Down-Syndrom künftig stärker gesellschaftlich ausgegrenzt, weil andere aufgrund der modernen Diagnosemöglichkeiten sagen: Muss das denn heute noch sein? Wird es weniger Menschen mit solchen Besonderheiten in den Genen geben? „Wir werden keine behindertenfreie Gesellschaft, nur, weil es unseren Test gibt“, antwortet Hofmann.
„Auch unabhängig von genetischen Erkrankungen gibt es für jede schwangere Frau ein gewisses Basisrisiko für Fehlbildungen und Erkrankungen beim Neugeborenen. Außerdem müsste man dann die gesamte Pränataldiagnostik in Frage stellen. Unsere Gesellschaft aber hat sich im Rahmen der Schwangerenvorsorge entschieden, auch diese Tests zuzulassen, und die Nachfrage ist da. Wenn all diese Frauen stattdesseninvasiv untersucht würden, bestünde für viele von ihnen das unnötige Risiko einer Fehlgeburt oder anderer Schwangerschaftskomplikationen.“ Hinzu kommt eine entscheidende Sache, die angesichts des großen Angebots vorgeburtlicher Untersuchungen gerne aus dem Blick gerät: Die wenigsten Krankheiten und Behinderungen sind angeboren, und davon ist ohnehin nur ein kleiner Teil vor der Geburt zu erkennen.
Wie es zu diesem Artikel kam – und welche Gesprächspartner ich hatte
- Anlass dieser Recherche war eine Pressemitteilung der Konstanzer Firma Lifecodexx, die verkündete, den 80.000 Praenatest durchgeführt zu haben. Pränataldiagnostik ist ein lukratives Geschäftsmodell und heftig kritisiert. Aber auch tausendfach genutzt.
- Gesprächspartner: Bei der Firma Lifecodexx habe ich Wissenschaftler kennen gelernt, die zu hundert Prozent hinter ihrem Produkt stehen und sich der ethischen Fragen sehr wohl bewusst sind. Im Konradihaus Konstanz habe ich mit dem Heilpädagogen Andreas Laube über die Fördermöglichkeiten von Kindern mit Behinderung und eine Ethik der Zukunft gesprochen. Das vollständige Interview finden Sie hier. Ich habe ältere Frauen getroffen, die sagen: Hätte es diesen Test doch nur schon früher gegeben. Und solche, die sich bewusst dagegen entschieden haben, wie Marion Bahm. Sie traf ich das erste Mal alleine an ihrem Arbeitsplatz bei der Caritas Konstanz. Spontan lud sie mich ein, Robin und ihre Familie bei ihr zuhause auch persönlich kennenzulernen. Schon an der Tür begrüßte mich Robin herzlich und ich kann alle verbissenen Omas verstehen, die sich dann auch ein Lächeln abgewinnen – wie bei jedem anderen Kind auch. Ich habe eine Familie kennen gelernt, die nichts beschönigt, aber einen ehrlich glauben lässt: Wir sind glücklich mit diesem Kind. Genauso gibt es glückliche Familien, die sich entschieden haben, das Kind nicht zu bekommen.
- Und jetzt? Jede Frau kann am Ende selbst entscheiden, muss das aber nicht alleine bewältigen. In Konstanz beispielsweise bietet Pro Familia kostenlose Beratungen an – psychologische, medizinische und juristische. (www.profamilia.de), telefonische Terminvereinbarung unter 07531/26 390. Auch Marion Bahm kann man kontaktieren, am einfachsten per Mail an die konstanz.redaktion@suedkurier.de. Wir leiten die Mails dann weiter.






