Der Begriff „Erinnern“ steht ganz zentral im Mittelpunkt des Kulturschwerpunkts 2020/21 des Landkreises Sigmaringen. Dabei geht es aber nicht nur um den Blick über die Schulter zu Ereignissen der Vergangenheit. Einige der insgesamt rund 60 Veranstaltungen zwischen Sommer 2020 bis Sommer 2021 beschäftigen sich mit der gesellschaftspsychologischen Dimension des Erinnerns. Wie Kulturamtsleiter Edwin Ernst Weber und Landrätin Stefanie Bürkle bei der offiziellen Vorstellung des Programms betonten, geht es nicht ausschließlich um das Erinnern an konkrete Ereignisse und Personen auf dem Gebiet des heutigen Kreises Sigmaringen an sich. In einigen Veranstaltungen gehe es auch um den eigentlichen Umgang der Gesellschaft mit den Ereignissen der Vergangenheit. Ein Schwerpunktthema werden die Spuren sein, die der Nationalsozialismus im Kreis hinterlassen hat.
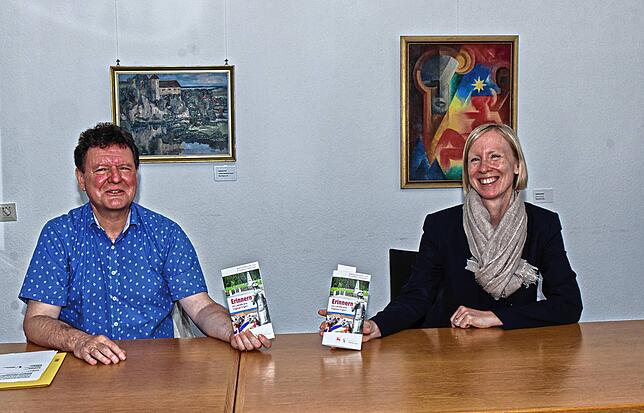
Kritischer Blick auf Denkmäler, Straßennamen und Ehrenbürgerschaften
Edwin Ernst Weber machte an zwei konkreten Beispielen deutlich, wie die aktuelle historische Forschung und die interessierte Öffentlichkeit mit den Relikten der braunen Diktatur heute umgehen. Denkmäler, Straßennamen und Ehrenbürgerschaften werden kritisch unter die Lupe genommen. Der Kreisarchivar nannte als Beispiel die Diskussion in Meßkirch um die beiden Ehrenbürger Erzbischof Gröber und den Philosophen Martin Heidegger. Dabei geht es nicht so sehr um die Frage, inwieweit die beiden historischen Persönlichkeiten in das Hitlerregime verstrickt waren, sondern wie die Meßkircher bis heute mit der Erinnerung umgehen. Als „tolle Sache“ bezeichnete Weber die Aktion von Schülern des Martin-Heidegger-Gymnasiums, in deren Verlauf der bislang unbekannte Name eines auf dem Todesmarsch ermordeten KZ-Häftlings gefunden werden konnte.
Erläuternde Texte zu Erinnerungsstätte für Wehrmachtssoldaten?
Das zweite Beispiel für eine veränderte Erinnerungskultur macht der Kulturamtsleiter auf der Eremitage im Fürstlichen Park bei Inzigkofen aus. Dort befindet sich seit Jahrzehnten eine Erinnerungsstätte für die gefallenen Wehrmachtssoldaten der Schlacht von Stalingrad im Winter 1942/43. Die dort in Stein gehauene Aufschrift „In Erinnerung an unsere Helden von Stalingrad„ entspräche nicht mehr dem heutigen Verständnis, nachdem die dort gefallenen Soldaten eher Opfer als Helden sind, und besonders im Hinblick auf die deutschen Kriegsverbrechen in der damaligen Sowjetunion. „Sollen solche Relikte beseitigt werden oder bedarf es einer erläuternden Kontextualsierung etwa in Form einer Infotafel?“, diese Frage stellt der Kreisarchivar bei einem Vor-Ort-Termin auf der Eremitage am 13. September. Sowohl Weber als auch die Landrätin machten deutlich, dass sie wenig von der Beseitigung solcher Spuren halten. Vielmehr plädieren beide Verantwortungsträger dafür, mit erklärenden Texten auf die heutige Sichtweise aufmerksam zu machen. Es gelte, „die Vergangenheit in den Kontext zur der Gegenwart“ zu stellen.
Gedenken an russische Kriegsgefangene und Konzentrationslager
Wie sehr sich die große Geschichte und Menschenschicksale in der Region überschneiden, wird besonders an den Erinnerungsstätten auf dem Truppenübungsplatz Heuberg bei Stetten a.k.M. deutlich. Hier gibt es nicht nur den „Russenfriedhof“ mit den Gräbern russischer Kriegsgefangener aus dem Ersten Weltkrieg, sondern bei der Dreidrittenkapelle das Mahnmal für eines der ersten Konzentrationslager der Nationalsozialisten im Deutschen Reich. An diesem Gedenkort ist für den 11. Juli 2021 eine musikalische Lesung mit Berthold Biesinger und Wolfram Karrer vom Theater Lindenhof vorgesehen.
Film über Widerstandskämpferin Sophie Scholl
In Krauchenwies wird im Rahmen des Kulturschwerpunkts an die Widerstandskämpferin Sophie Scholl erinnert. Sie lebte im Rahmen ihrer Dienstverpflichtung beim Reichsarbeitsdienst (RAD) 1941 sechs Monate in Krauchenwies. Im Februar 1943 wurde Scholl zusammen mit ihrem Bruder und einem Studienkollegen in München hingerichtet. 78 Jahre nach ihrem Tod wird am 25. Februar 2021 im Krauchenwieser Rathaus der 2005 gedrehte Spielfilm „Sophie Scholl„ gezeigt, in dem die letzten Tage der Widerstandskämpferin gezeigt werden. In Bad Saulgau arbeitete Georg Metzler die Geschichte des KZ-Außenlagers auf. 400 Häftlinge mussten hier ab 1943 Zwangsarbeit für die Kriegsindustrie in Friedrichshafen leisten. 35 Opfer des Außenlagers von Dachau sind auf dem Friedhof der ehemaligen Kreisstadt bestattet. Zwei entgegengesetzte Pole treten in der Saulgauer KZ-Geschichte zutage. Auf der einen Seite ein humaner KZ-Kommandant, der den SS-Wachen die Schikane gegenüber den Häftlingen verbot. Auf der anderen Seite eine Gruppe von Saulgauer Landwirten, Volkssturm-Männern, Frauen und Schülern, die sich aktiv an der Suche nach einem entflohenen KZ-Häftling beteiligten. Der Geflüchtete beging Selbstmord
Breite Diskussion ist angedacht
Ereignisse und Erinnerungen an die Zeit des Faschismus sind jedoch wie erwähnt nur ein Aspekt des neuen Kulturschwerpunkts. Weber: „Wir wollen die Bevölkerung zum gemeinsamen Nachdenken darüber einladen, was und wer uns in den Städten und Dörfern, in Landkreis und Region erinnerungswürdig erscheint und welche Relikte des Gedenkens schwierig oder gar problematisch sind.“ Öffentliche Diskussionen zu diesen Fragen sind aus Sicht der Kreisverwaltung „vitaler Ausdruck einer öffentlichen Selbstverständigung über die Wertmaßstäbe in einem freiheitlich-demokratischen Gemeinwesen. Öffentliche Diskussionen zu diesem Thema seien daher wichtig und dürften keinesfalls unterbunden werden. Das betrifft nicht nur die zwölf braunen Jahre. Aktuell sind deutschlandweit beispielsweise auch Straßenbenennungen nach Persönlichkeiten aus der Zeit des Kolonialismus umstritten.
Zeitzeuge Willi Rößler erzählt aus seinem Leben
Wichtig für die historische Aufarbeitung sind besonders die letzten noch lebenden Zeitzeugen aus der NS-Zeit. Der 93 Jahre alte Sigmaringer Willi Rößler hat den Zweiten Weltkrieg und die Nachkriegszeit als Hitlerjunge und Soldat als Heimatvertriebener erlebt. Er wird im Rahmen eines Vortrages im Bildungszentrum Sigmaringen am 18. September über diesen Lebensabschnitt berichten.
Auch Demenz und Antijudaismus werden thematisiert
Wie breit das Themenspektrum „Erinnern“ angelegt ist, zeigt ein Blick in das Programmheft. Am 8. Oktober lädt die Theatergruppe von Lilo Braun mit einer Aufführung im Pfarrsaal zum Thema „Demenz“ ein. Selbstkritisch setzt sich der katholische Theologe Clemens Mayer im Bildungszentrum Gorheim an fünf Abenden mit dem Antijudaismus der christlichen Kirche als Wegbereiter für den rassischen Antisemitismus auseinander. In Mariaberg wird am 13. Dezember des 80. Jahrestages der Deportation behinderter Heimbewohner in der Mordanstalt Grafeneck gedacht.
Kulturschwerpunkt 2020/2021
Der jährliche Kulturschwerpunkt ist, wie Landratsamtspressesprecher Tobias Kolbeck erklärt, eine Veranstaltungsreihe des Kreiskulturforums Sigmaringen. Darin sind Vereine, Organisationen und Einzelpersonen zusammengefasst, die sich in der Regel ehrenamtlich mit den unterschiedlichen Bereichen der Kulturarbeit beschäftigen. Vorsitzender ist Edwin Ernst Weber. Der Landkreis stellt den organisatorischen Rahmen und beteiligt sich an den Kosten. Das Jahresbuget liegt bei 15 000 Euro.
Informationen im Internet:
Kulturschwerpunkt







