Mögen die Deutschen auch auf fast nichts mehr stolz sein, auf eines sind sie es dann irgendwie doch: den Umgang mit den dunklen Seiten ihrer Geschichte. Weil Generationen von Geschichtslehrern nicht müde geworden sind, aufzuklären über die Verbrechen der Nazis, und weil Millionen Jugendliche Gedenkstätten besucht haben, ist das Wunder der Versöhnung überhaupt möglich geworden. So jedenfalls hört es sich an, wenn hochrangige Politiker Bilanz ziehen, fast 80 Jahre nach Ende des Dritten Reichs. Oder stimmt daran etwa irgendwas nicht so ganz?
Max Czollek ist unter den Linksintellektuellen unserer Zeit der profilierteste Vermittler einer jüdischen Perspektive (auch wenn seine eigene jüdische Identität umstritten sein mag). Wo andere vom Versöhnungswunder reden, spricht er in seinem neuen Buch von einem „Versöhnungstheater“: von einer Inszenierung, deren einziger Zweck darin besteht, „Wiedergutwerdung ohne Wiedergutmachung“ zu erlangen.
Salbungsvolle Reden setzen in diesem Theater den Ton, etwa jene von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier 2020 anlässlich des 75. Jahrestags der Befreiung von Auschwitz. „Erfüllt von Dankbarkeit“ sei er, erklärte das Staatsoberhaupt damals: „für die ausgestreckte Hand der Überlebenden, für das neue Vertrauen von Menschen in Israel und der ganzen Welt.“ Ganz „beseelt“ sei er „vom Geist der Versöhnung“!
Nur: Wer hat da überhaupt seine Hand ausgestreckt? Wo genau ist es wirklich gekommen zu den so gepriesenen versöhnlichen Umarmungen? Und welche Personen wären zu einer solchen Geste im Namen der Opfer überhaupt legitimiert?
„Es soll gar nicht gut werden“
Wer nach Beispielen sucht, kommt in Verlegenheit. Dass selbst ein so monströses Menschheitsverbrechen wie der Holocaust bereits den Keim der Vergebung in sich birgt, diese Vorstellung erinnert statt der klassisch jüdischen Glaubenslehre eher an christliche Erlösungsvorstellungen.
Und so finden sich in den von Nazi-Opfern hinterlassenen Aufzeichnungen ganz andere Aussagen. „Wenn ihr könnt, dann nehmt einst Rache“, heißt es im Abschiedsbrief einer Musiklehrerin aus Tarnopol. Und der Schriftsteller Johannes Urzidil mahnt: „Der Leser fragt, wie soll das alles überhaupt jemals wieder gut werden? Die Antwort lautet: Es soll gar nicht ‚gut‘ werden!“
Die Aussagen der Opfer sind das eine, die Absichtsbekundungen der Täter-Nachkommen ein anderes. Mit feinem Gespür für die Bigotterien des Versöhnungstheaters zeichnet Czollek nach, wie den hehren Worten meist nur wenige Taten folgten. An einer juristischen Aufarbeitung war der deutsche Staat über Jahrzehnte hinweg nur in sehr beschränktem Umfang interessiert, und wer finanzielle Entschädigung forderte, schaute meist in die Röhre.
Auf überraschende Weise erhellend ist in diesem Rückblick der Brückenschlag zur aktuellen Symbolpolitik der identitären Linken, die mit ihren Sprachregelungen und Diversitätsfloskeln auf ganz ähnliche Weise die Abwesenheit von Taten durch ein Überangebot an Formen wettzumachen versucht. Dass er diese blinden Stellen auch in der eigenen politischen Kultur kenntlich macht, spricht für Czollek.
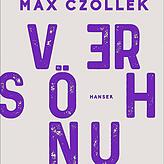
Was aber ist nun das eigentliche Problem an der Differenz zwischen Sein und Schein? Es liegt in der erkennbaren Tendenz, aus dem Mythos einer vermeintlichen großen Versöhnung ein neues fragwürdiges Selbstverständnis zu ziehen. Beispielhaft dafür erwähnt Czollek die umstrittene Rekonstruktion des Berliner Stadtschlosses inklusive Kuppelkreuz und eine den Imperialismus verherrlichende Inschrift. Die Logik dahinter: „Weil wir so intensiv an die ‚negativen‘ Seiten der deutschen Geschichte erinnert haben, dürfen wir nun auch ihre ‚positiven‘ Aspekte zelebrieren.“
Es ist durchaus bezeichnend, wie umstandslos sich ausgewiesene Demokraten dabei einer populistischen Rhetorik annähern. Wenn etwa der ehemalige Bundestagspräsident Wolfgang Thierse dafür wirbt, das „Ernstnehmen der Vergangenheit“ doch nicht ausgerechnet darin zu suchen, „mit den Verlusten zu leben, also die offene Wunde der historischen Mitte Berlins verewigen zu wollen“: Dann scheint das argumentativ gar nicht so weit entfernt von AfD-Politiker Alexander Gauland, der zwölf Jahre Hitler bekanntlich zu einem Vogelschiss erklärte.
An Czolleks Analyse einer zum Zweck der Selbstentlastung erfundenen Versöhnungsschmonzette ist so vieles auf so scharfsinnige Weise konsequent und richtig, dass man beinahe ihren zentralen Fehler übersieht. Er liegt in gerade dieser unerbittlichen Konsequenz. Am Ende, schreibt der Autor, werde es darum gehen, „Geschichte nicht mehr als einen Ort der positiven Identifikation zu verstehen, sondern als Mahnung, wie schlimm Dinge werden können“.
Dass einem solch verengten negativen Geschichtsverständnis der Keim des Extremismus schon eingepflanzt ist, scheint er nicht wahrhaben zu wollen: Geschichte ist selbst mehrdimensional, sie sollte auch mehrdimensionale Lesarten zulassen.
So zeigt auch die Inszenierung des Versöhnungstheaters eine helle Seite. Immerhin erzählt sie die Geschichte von einem Volk, welches sich nichts sehnlicher wünscht, als seine Vergangenheit zu korrigieren: so sehr, dass es ihm scheint, als sei dies schon längst geglückt. Wenn diese Bühnenillusion den Sinn für die Wirklichkeit schärft, statt von ihr abzulenken, kann aus ihr noch Gutes entstehen.







