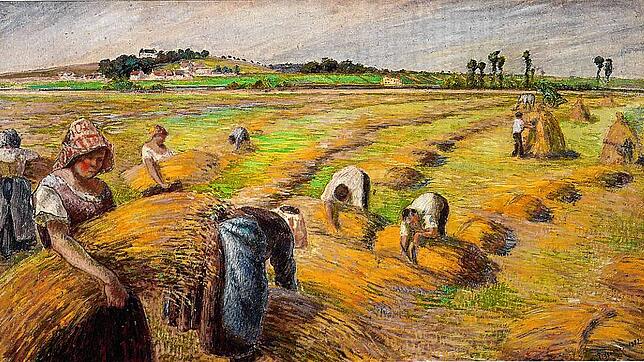Die schlechte Nachricht zuerst: Die Namenberatungsstelle in Leipzig wird in zwei Jahren ihre Dienste einstellen. Die Einrichtung, von DDR-Kulturpolitikern in den frühen 60er-Jahren gegründet, läuft aus, genauer gesagt: Sie erhält vom Land Sachsen nicht mehr die Unterstützung, ohne die das kleine feine Institut nicht überleben kann. Dabei hatte es stets gute Arbeit geleistet.
Es hatte Menschen beraten, die vielleicht einen ungewöhnlichen Namen tragen und nun wissen wollten, woher ihr Name und damit ihre Familie kommt. „Das ist eine unerfreuliche Geschichte“, sagt Frau Kremer, die selbst mit dem herrlichen Vornamen Dietlind gesegnet ist. „Ich hatte immer volle Hütte. Ich verstehe nicht, dass geschlossen wird“, sagt sie am Telefon. Aber so ist es: Wenn sie bald in den Ruhestand tritt, wird auch die staatlich finanzierte Namensberatung eingestellt.
Die gute Nachricht: Wer mehr über seinen Stammesnamen erfahren will, steht deshalb nicht ohne Hosen da. Was in Leipzig ausläuft, wird in Mainz im großen Stil aufgebaut. „Sie müssen sich an den ‚Digitalen Familienatlas Deutschland‘ wenden“, sagt Dietlind Kremer im Gespräch, „dort erfahren Sie alles.“
Onomastik spielt kaum mehr eine Rolle
Das stimmt dann nur zum Teil, wenn man die Homepage der Mainzer aufschlägt und dort nähere Auskunft über einzelne und vor allem: spezielle Familiennamen wünscht. Die Auskünfte sind eher oberflächlich und summarisch. Wem ist schon damit gedient, zu wissen, dass es den Namen Müller so und so oft gibt? Dass er ebenso wie die Meiers vielfach in Deutschland auftaucht?
Bei der Suche nach Sinn und Herkunft der Namen wird schnell deutlich: An den Universitäten spielt das Fach Onomastik (griechisch für Namenskunde) kaum eine Rolle. Siehe Dietlind Kremer, die dem Ende ihrer Beratungsstelle entgegensieht. An der Universität Konstanz nimmt sich aktuell niemand dieser Disziplin an. „Das Fach wird bei uns nicht mehr betrieben“, sagt Regine Eckardt im Austausch mit dem SÜDKURIER. Die Professorin für Linguistik lässt durchblicken, dass sie und ihre Kollegen eben andere Schwerpunkte setzen.
Die Kellers hatten gar keine Keller
Für alle Familienforscher und Ahnenkundler muss das kein Beinbruch sein. Wenn Hochschulen das Interesse an dieser Materie verloren haben, springt eine andere Institution in die Bresche. Gemeint ist der größte Wissensschatz, den die Menschheit bisher aufgehäuft hat – das Internet. Dort liegen Informationen zuhauf parat – so viele wiederum, dass der Suchende erst sortieren und gewichten muss, bevor er die Perlen aus dem großen Haufen zieht.
In einem Punkt sind sich Experten und Hobbyforscher einig: Die am häufigsten vertretenen Familien hören bis heute auf Namen, die sich von Berufen ableiten. Die Sippen heißen also Müller, Schmid, Wagner, Schneider, Bauer. Auch Maier (Mayer, Meyer, Meier oder österreichisch Mayr) ist ein solcher Berufsname, auch wenn die Herleitung heute fast verschüttet ist: Der Maier saß auf einem Maierhof und hatte dort das Sagen.

Dasselbe gilt auch für den harmlos klingenden Namen Keller. Die Vorfahren der heutigen Keller saßen keinesfalls im Untergeschoss ihrer Häuser, zumal gewöhnliche Wohn- oder Häuser im Mittelalter gar nicht unterkellert waren. Der Keller arbeitete vielmehr als Verwalter eines Kehlhofs/Kellhofs – eines größeren Gutshofs, über den ihn sein Herr gesetzt hatte. Das konnte ein Bischof, Abt oder ein weltlicher Adliger sein.
Bei den häufigen Sippenbezeichnungen gestaltet sich die Herleitung einfach. Sie verweisen auf eine Tätigkeit – in aller Regel sind es Handwerke, die ihre Träger offenbar beherrscht haben. Da diese praktischen Fachleute überall gebraucht wurden, sind die Namen im gesamten Sprachraum verbreitet. Vom ehemaligen Ostpreußen bis in die Nordschweiz trifft man auf Menschen mit dem Nachnamen Müller oder Schmid (Schmitt, Schmidt etc.). Das bedeutet aber auch: Wer einen dieser häufigen Namen trägt, ist geografisch kaum zurückzuverfolgen. Für die Zwecke der Genealogie ist der Name kein brauchbarer Schlüssel.
War Böhler ein stolzer Hausbesitzer?
Interessanter wird die Suche bei seltenen Namen. So ist der in Baden häufig auftauchende Name Böhler bis heute nicht zufriedenstellend aufgeschlüsselt. Manche Wörterbücher deuten die Herkunft von Böhler als „Besitzer eines Herrenhauses“ oder überhaupt „Hausbesitzer“. Diese Interpretation ist aber umstritten. Böhler kann sich auch von der „ebenen Fläche“ ableiten, auf der diese Familie gewohnt haben mag. Viel schlauer ist man also nicht.
Für die Onomastiker sind derlei Unsicherheiten der Normalfall: An diesen Worten muss man lange arbeiten und abwägen, bis eine hilfreiche Deutung vorliegt. „Es ist normal, dass Namen verschieden entschlüsselt werden“, sagt Dietlind Kremer im Gespräch, und setzt einen wichtigen Nachsatz: „Das macht diese Forschung doch so spannend.“ Die Unschärfe in der Entschlüsselung liegt auch am Alter dieser Silben. „Die Namen sind im 12. und 13. Jahrhundert entstanden.“ Davor gab es keine festgeprägten und erblichen Sippennamen.

Ein Beleg ist der badische Name Schäuble (der auch durch den CDU-Politiker Wolfgang Schäuble bekannt wurde). Um ihn zu entschlüsseln, muss man in das 12. Jahrhundert zurück und auch in die Stufe des Deutschen, das damals gesprochen wurde. Im Mittelhochdeutschen bezeichnete das Wort „Schoup“ ein dürres Strohbündel. Übertragen auf den Menschen ist Schoup ein dürrer Mensch, ein Schäuble eben. Für den Namen stand also nicht der Beruf, sondern eine körperliche Eigenheit des Namensträgers Pate.
Ähnlich verhält es sich mit dem Schiller. Nicht zuletzt der Dichter gleichen Namens machte den Namen populär. Tatsächlich sind die Schillers im Schwäbischen weit verbreitet. Eine Herleitung bezieht sich auf ein körperliches Manko, das den ersten Schiller begleitete. Er schielte.

Aus dem „Schieler“ wurde ein Schiller. Heute wäre so eine Charakteristik kaum mehr möglich, sie würde sich dem Verdacht der Diskriminierung aussetzen. Doch war das staufische Mittelalter, in dem die meisten Sippen durch Namen voneinander unterschieden wurden, nicht so zimperlich wie die heutige Zeit.
Die Fallers sind vor allem im Schwarzwald verbreitet, da liegt die einschlägige TV-Serie ganz richtig. Faller zählt zu den Namen, die nicht eindeutig erklärt werden können. Manche Handbücher weisen die ersten Faller in die Nähe eines Wasserfalls. Eine andere Interpretation leitet diesen Namen vom Beruf des Holzfällers ab – eine Tätigkeit, die im Schwarzwald bis heute wichtig ist.
Weltin hatte Macht
Tief in die Sprachgeschichte greift der Name Weltin ein. In Südbaden ist er weitverbreitet und schon durch die Endung „in“ als alemannisch ausgezeichnet. Weltin leitet sich von der Silbe „walt“ ab und meint so viel wie „Herrschaft“ oder „Macht“. Der Clan, der als erster so gerufen wurde, dürfte über viel Macht verfügt haben. Der Vorname Walter hat übrigens dieselbe Wurzel.
Wenn Eltern früher ihre Söhne Walter nannten, dann wünschten sie ihnen tatsächlich diese Kräfte – also Macht, Einfluss, Wohlstand. Wobei auch klar ist: Den Vornamen können Eltern (und jene, die sie fragen) frei bestimmen. Den Nachnamen nicht – der fällt einem wie ein Pfund Blei auf die Füße.