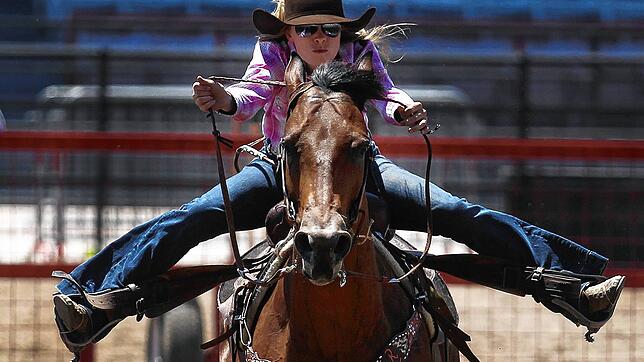Als feststehender Begriff hat sie sich zwar erst in den 80er-Jahren etabliert, begehrt war sie schon immer: Coolness. Wer nett ist, mag viele Freunde haben, und mit Ehrgeiz kommt man im Beruf voran. Allein der Coole aber räumt auf allen Feldern gleichzeitig ab: Er gewinnt Wahlkämpfe, macht Karriere, ist begehrt beim anderen Geschlecht und verliert bei alldem nie die Nerven.
Coole Typen regieren die Welt, und genau deshalb erregt aktuell eine Studie Aufsehen, die diesem Phänomen auf die Spur kommen soll. Obwohl nämlich weitgehende Einigkeit darin besteht, dass zum Beispiel der Schauspieler Daniel Craig als James Bond eine verdammt coole Figur abgibt, fehlt es bislang an einer belastbaren Definition dafür. Bedeutet Coolsein einfach nur ein gewisses Maß an Gelassenheit? Braucht es dazu auch Mut? Ist Nettigkeit ein Widerspruch?
Die Meinung der anderen interessiert ihn wenig
Das Ergebnis der Untersuchung ist vor allem deshalb bemerkenswert, weil die befragten fast 6000 Teilnehmer weitgehend identische Antworten geben. Und das, obwohl sie aus so unterschiedlichen Ländern kommen wie Australien und der Türkei, aus China und Nigeria, oder auch Chile und Indien.
Ganz gleich also, ob jemand in einer eher individualistischen oder kollektivistischen Gesellschaft aufwächst: Als „cool“ gilt überall der gleiche Typus Mensch. Und der ist nur bedingt sympathisch. Abenteuerlust, Offenheit und Unabhängigkeit zählen noch zu den positiven Eigenschaften. Darüber hinaus aber ist der Coole auch selbstbezogen, vergnügungssüchtig und machtbewusst. Er hütet sich zwar vor explizit antisozialem Verhalten. Und doch: Was andere über ihn denken, lässt ihn weitgehend kalt.
Die Wochenzeitung „Die Zeit“ zieht eine Linie zu einer zweiten Studie über Verkaufsstrategien für klimafreundliche Produkte wie etwa E-Autos. Der Appell ans moralische Gewissen der potenziellen Kundschaft liegt ja in deren Natur. Tatsächlich aber beweist etwa die Erfolgsgeschichte von Elon Musks Tesla, dass nur die gegenteilige Strategie zieht: nämlich mit protzigen Limousinen eher zweifelhafte Bedürfnisse zu bedienen wie Hedonismus und Machtstreben.
Der wissenschaftliche Befund erklärt nun also nicht nur, was wir unter Coolness verstehen müssen. Er dürfte auch Marketingexperten eine Vorstellung davon vermitteln, wie sie Produkte mit moralischem Anspruch an den Mann und die Frau bringen können. Demnach sollten sie diesen Anspruch gut verstecken und stattdessen eine „Ihr-könnt-mich-alle-mal“-Attitüde betonen.
Die Studie
Die eigentlich interessante Frage aber bleibt offen: Warum überhaupt ist die solcherart definierte Coolness weltweit so populär? Was treibt die Menschheit dazu, Typen zu bewundern, die ihr Desinteresse an anderen Menschen und Meinungen zur Schau stellen und meist den eigenen Vorteil im Blick haben?
Die Antwort lautet wohl: Es liegt in ihrer Natur. Daran, es zu ändern, scheitert in Fjodor M. Dostojewskijs Roman „Die Brüder Karamasow“ niemand Geringeres als Jesus Christus. Im Kapitel „Der Großinquisitor“ lesen wir noch einmal die Geschichte von seiner Begegnung mit dem Teufel in der Wüste. Zur Erinnerung: Erst soll der Messias Steine in Brot verwandeln, dann mit einem Sturz vom Tempeldach Gottes Beistand testen und schließlich sogar den Satan anbeten. Jesus hält bekanntlich allen Versuchungen stand: Weder lebt der Mensch vom Brot allein, sagt er, noch stellt er seinen Gott auf die Probe. Und schon gar nicht wirft er sich vor einem dahergelaufenen Teufel in den Staub!
Unbedingt jemanden anbeten!
Der Mensch als freies Wesen, immun gegen alle Versuchungen, fest im Glauben, unterwürfig allein gegenüber seinem Gott. So sollte er sein, so hat es ihm der Messias vorgelebt. Aber der Mensch, er ist zu schwach dafür.
Anders als Jesus zieht er das Fressen der Moral vor, glaubt auch nur, was zuverlässig erprobt ist. Und: Er wirft sich mit Lust vor anderen in den Staub. „Es gibt für den Menschen, wenn er frei geblieben ist, keine dauerndere quälendere Sorge, als möglichst rasch jemanden zu finden, den er anbeten kann“, heißt es bei Dostjewski. Und sind die Götter verschwunden, „werden sie eben vor Götzen niederfallen“. Mit Vorliebe solchen, die Hedonismus, Macht und Selbstbezogenheit ausstrahlen. Man nennt es heute cool.