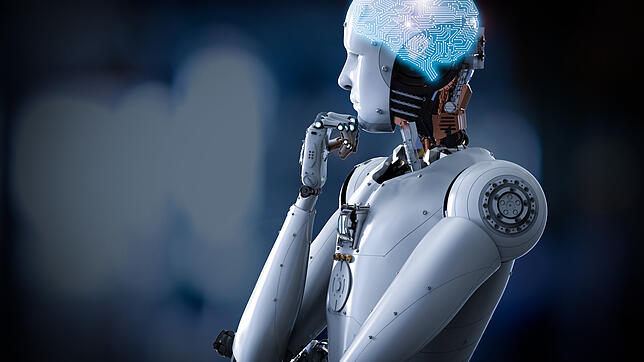Herr Igel, wenn ich mit Siri auf meinem Smartphone spreche, unterhalte ich mich mit einer Künstlichen Intelligenz, die auch schlagfertig sein kann. Ist das der nächste Evolutionsschritt der Digitalisierung?
In der Tat befinden wir uns im Übergang von der ersten zur zweiten Welle der Digitalisierung. In der ersten Digitalisierungswelle wurden Daten digital erfasst, sie wurden gespeichert, verarbeitet und übertragen. Das heißt, in der ersten Welle waren Daten lesbar für Computer, wurden mit Internet-Technologien genutzt. In der neuen zweiten Digitalisierungswelle werden Computer Daten verstehen lernen. Es können Schlussfolgerungen gezogen und Empfehlungen ausgesprochen werden. Und vielleicht verstehen Computer bald auch Witze oder ironische Anmerkungen. Für diese zweite Welle der Digitalisierung sind Methoden der Künstlichen Intelligenz erforderlich.
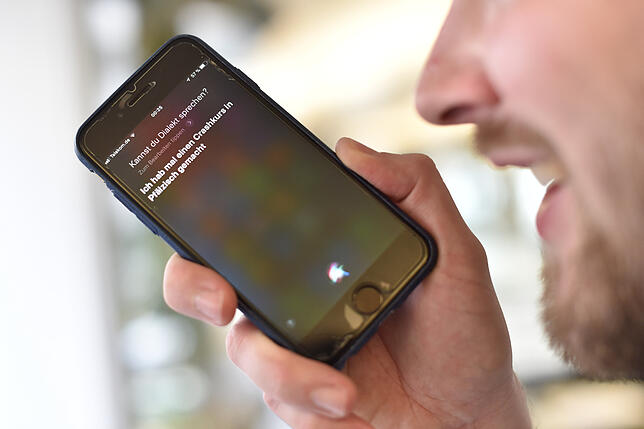
Ich glaube, Sie müssen mir erst mal erklären, was man unter Künstlicher Intelligenz, kurz KI, verstehen kann.
Bis heute ist KI so etwas wie die Denkfabrik der Informatik. Hier entstehen viele neue Impulse, abgeleitet aus der Beobachtung menschlichen Verhaltens und dem Versuch, dieses durch Computer nachzuahmen. Dies gilt etwa für die Wahrnehmung mit unseren Sinnesorganen, die immer stärker in Softwareanwendungen zum Einsatz kommt, beispielsweise durch die Akustik, mit haptischen oder auch taktilen Anwendungen, in dem etwas „begriffen“ wird. Und es gilt auch für menschliche Kognitionen und Aktionen.
Was bedeutet das?
Kognitionen meint ja all jene Vorgänge, die im Kopf vorgehen, wie das Denken. Auch hier versucht man, Computer intelligent zu machen. Und Aktionen meinen etwa das Greifen, das Laufen und Gehen, aber auch das Handeln in Arbeitssituationen. Wie derartige Aktionen der Computer zukünftig durchführen kann, ist auch ein Bestandteil der KI. Wir versuchen somit also der menschlichen Intelligenz näher zu kommen.
Sind KIs intelligenter als Menschen?
Das Wort Intelligenz legt einen solchen Vergleich vermeintlich nahe. Ich werde oft gefragt, ob wir die von uns entwickelte Künstliche Intelligenz eigentlich auch einem Intelligenztest unterziehen würden. Ich denke, dass man nicht der Vorstellung erliegen sollte, dass Künstliche Intelligenz der menschlichen Intelligenz ähnlich ist. Oder dass es eine Künstliche Intelligenz gibt, die in allen vorstellbaren Bereichen der menschlichen Intelligenz überlegen ist und daher alsbald sich den Menschen untertan machen wird. Das sind Dystopien, die in Hollywood-Filmen vorkommen, jedoch wenig mit der Realität zu tun haben.
Sind Künstliche Intelligenzen uns Menschen eher freundlich gesinnt, wie Disneys niedlicher Roboter Wall-E oder der Androide C3PO aus Star Wars?
Künstliche Intelligenz ist weder freundlich noch unfreundlich. Weder wohlwollend noch neidend. Sie ist, wie sie ist – eine Computeranwendung. Menschen weisen einer KI situativ derartige Attribute zu, machen sie menschlicher oder menschähnlicher.
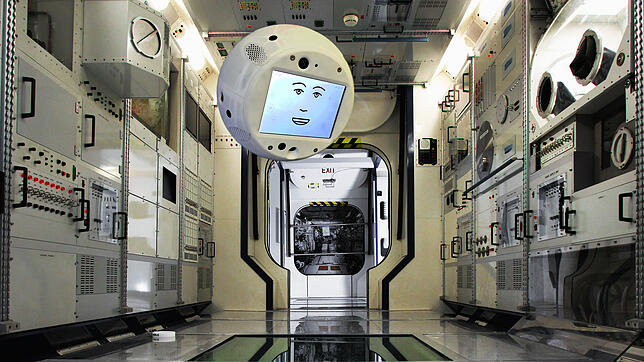
Künstliche Intelligenzen sind also nicht schlauer als der Mensch?
Bei kognitiven Aufgaben ist Künstliche Intelligenz zweifelsohne dem Menschen in ausgewählten Anwendungen überlegen. In der Sensomotorik hingegen ist KI in einem frühen Entwicklungsstadium und weit von menschlicher Motorik entfernt. Emotionales Verhalten oder soziale Intelligenz sind bislang in der KI nur wenig erforscht, hier ist der Mensch ganz klar besser. Und dies wird meiner Einschätzung nach noch sehr lang so bleiben.
Tesla-Erfinder Elon Musk befürchtet dagegen, dass eine KI zu einem unsterblichen Diktator werden könnte. Können Sie also Entwarnung geben?
Definitiv. Der Glaube an eine starke KI, eine allmächtige Künstliche Intelligenz, die auch noch die Menschen bedroht, teile ich nicht. Ich mache mir vielmehr Sorgen um uns Menschen.
Warum?
Wenn die KI-Entwicklungen rasch voranschreiten und Menschen feststellen, dass sie immer mehr Aufgaben an eine KI übertragen können – was bleibt dann für uns? Wie erfahren wir Wertschätzung? Was werden unsere Aufgaben sein? Was ist dann unser Lebenssinn? Was tun wir mit der dann uns vielleicht gegebenen Zeit? Ich bin mir nicht sicher, ob wir auf derartige Fragen gute Antworten haben und darauf wirklich vorbereitet sind.
Laut einer Umfrage glauben nur 15 Prozent der Deutschen, dass der Nutzen die Risiken der KI übersteigt.
Die Frage nach dem Nutzen des Digitalen, auch von Künstlicher Intelligenz, ist eine in der Wissenschaft schon lange diskutierte. Heute mag man über KI-basierte Erkennung von Krankheiten auf Röntgenbildern den Kopf schütteln. Wenn man krank ist und mit KI eben eine Krankheit diagnostiziert werden kann, die vielleicht das menschliche Auge nicht detektiert hat, wird man dankbar für die KI sein. Nutzen entsteht für Menschen in Situationen.

Im Gegenzug dazu eine Bitkom-Umfrage: 41 Prozent der Deutschen können sich vorstellen, sich von einem Roboter pflegen zu lassen. Würden Sie das auch tun?
Sicherlich würde ich meinen Lebensabend lieber mit meiner Frau und meiner Familie verbringen. Aber warum nicht auch ein Pflegeroboter ergänzend hierzu, der mein Umfeld entlasten kann? Das könnte ich mir doch recht gut vorstellen. Ich muss ihn ja nicht gleich lieben (lacht).
Aber besteht nicht die Gefahr, dass Roboter uns Arbeitsplätze streitig machen? Macht bald eine KI unsere Steuererklärung oder operiert uns?
Künstliche Intelligenz hat unzweifelhaft etwa bei der Verarbeitung großer Datenmengen und bei sich häufig wiederholenden, stark kognitiven Tätigkeiten ihre Stärken. Studien über die Arbeitsmarktentwicklung zeigen auf, dass standardisierte Arbeiten eine hohe Ersetzungsgefahr durch KI haben. Wird KI also die Sachbearbeiter ersetzen? Ich würde diese Überlegung in der Tat nicht allzu weit von uns weisen wollen. Aber wir haben noch Zeit, die wir nutzen müssen, um Menschen in derartigen Jobs zu qualifizieren. Wir müssen alle eine Ebene höher.
Wo begegnet uns KI überhaupt schon?
In vielen kleinen und größeren Anwendungen. Täglich. Auf Online-Plattformen, wenn Empfehlungen ausgesprochen werden. Beim Autofahren und der Nutzung der Navigation auf Basis aktueller Verkehrsmeldungen. Oder zu Hause mit Alexa, Siri und Co. Es ist wichtig, dass wir uns dies bewusst machen. Die ein oder andere Debatte suggeriert das Bild einer plötzlich über uns kommenden Künstlichen Intelligenz, quasi aus dem Himmel. Wir sollten bedenken, dass KI sich seit vielen Dekaden entwickelt und nun in praktischen Anwendungen vorkommt.

Wir nutzten KI also schon vielfach, ohne es wirklich zu merken.
Genau, denken wir nur an die intelligenten Suchmaschinen im Internet. Da haben wir die KI nicht mal bemerkt. Wir sollten erkennen, dass derzeit ein gewisser öffentlicher Fokus auf dem Thema KI liegt. So wie es in den letzten Jahren etwa mit Themen wie Industrie 4.0, Internet der Dinge oder Plattform-Ökonomie gewesen ist. Das erzeugt eine gewisse Aufgeregtheit, vielleicht auch Unruhe und persönliche Unsicherheit. Der Hype um Künstliche Intelligenz wird sich auch wieder legen. Es ist wichtig, sich damit auseinanderzusetzen. Und aus der Wohlfühlzone rauszukommen, sich zu qualifizieren und positiv nach vorne zu blicken.
Fragen: Kerstin Steinert
Zur Person
Christoph Igel, 50, ist wissenschaftlicher Direktor Educational Technology Lab des Deutschen Forschungszentrums für Künstliche Intelligenzen (DFKI) in Berlin. Er ist Inhaber der Professur für Bildungstechnologie an der Technischen Universität Chemnitz. Igel studierte Geschichte, Sport, Pädagogik und Politik.