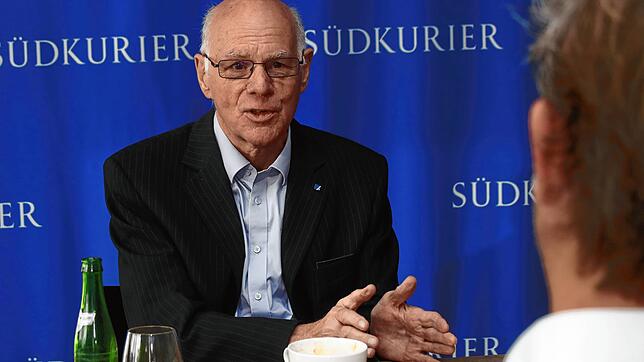Herr Lammert, warum sieht man Sie eigentlich nie in politischen Fernseh-Talkshows?
Weil diese Talkshows häufig das sind, was der Name verspricht: Shows – und nicht ernsthafte politische Formate. Allein die Zusammensetzung der Teilnehmer folgt erkennbar dramaturgischen Prioritäten und nicht Kompetenzprioritäten. Nicht selten scheint die wichtigste Aufgabe der Moderatorin oder des Moderators darin zu bestehen, einzugreifen, wenn eine ernsthafte Diskussion auszubrechen droht, und zugunsten eines Einspielers oder eines anderen Unterhaltungselements die Anwesenheitsquote der sich durch die Programme zappenden Zuschauer zu sichern. Da die allermeisten anspruchsvollen Fragen sich nicht in zwei oder drei Sätzen beantworten lassen, sollen die Leute dahin gehen, die das können. Ich kann es nicht.
Sie haben es also nie versucht?
Ich habe allen angeboten, zu kommen – aber nur unter der Zusage, dass ich auf eine komplizierte Frage in mehreren aufeinanderfolgenden Sätzen antworten kann, ohne unterbrochen zu werden. Das konnte mir keiner garantieren.
Sie sagen, das sind Shows. Die Sender sagen, das ist Politikvermittlung. Waren politische Debatten nicht schon immer inszeniert?
Wenn Politik unter Wettbewerbsbedingungen stattfindet, dann immer auch unter dem Gesichtspunkt der optimalen Erreichbarkeit eines Publikums. Umgekehrt gibt es in den Medien die notwendige Anstrengung, Themen und Inhalte einem möglichst großen Publikum beizubringen. Dennoch gehört für mich zu den ärgerlichsten Veränderungen der letzten Jahre und Jahrzehnte, dass es unter dem Druck insbesondere der elektronischen Angebote einen gnadenlosen Trend zur Entertainisierung von allem und jedem gibt. Aus dem Buch von Neil Postman „Wir amüsieren uns zu Tode“ ist mir vor allem ein Schlüsselsatz im Gedächtnis geblieben: Das Problem ist nicht, dass das Fernsehen zu viel Unterhaltung bringt, sondern dass das Fernsehen aus allem und jedem Unterhaltung macht.

Sind Sie mit dieser Kritik im Politik-Geschäft ein einsamer Rufer im Walde?
Nein, ganz sicher nicht. Wenngleich es zu meinen ernüchternden Erfahrungen gehört, dass sich Kolleginnen und Kollegen im Bundestag, die Gremienmitglieder in Fernsehanstalten waren oder sind, bei meinen öffentlichen Erinnerungen an deren Programmauftrag eher als Interessenvertreter der Fernsehanstalten verstanden haben und nicht als Interessenwahrer des Parlaments gegenüber den Fernsehanstalten. Da hieß es dann: Herr Präsident, übertreiben Sie mal nicht.
Ist denn umgekehrt Ihr Eindruck, dass beispielsweise Tageszeitungen die politische Debatte anders abbilden?
Natürlich macht sich der Wettbewerb in allen Medien bemerkbar, insbesondere indirekt: Anzeigenrubriken brechen wegen digitaler Angebote weg, der Handel konzentriert sich, das alles hat finanzielle Folgen für die Gestaltungsmöglichkeiten von Redaktionen. Aber an einer Stelle haben Regionalzeitungen einen nicht einholbaren Vorsprung gegenüber den überregionalen Medien: Lokalredakteurinnen und Lokalredakteure wissen oftmals Dinge, die nicht einmal Google weiß. Aus der Leserperspektive macht das eine Regionalzeitung schwer verzichtbar, sei es in gedruckter oder in elektronischer Version.
Wenn im ländlichen Raum die Zustellung von Tageszeitungen schwieriger wird und digitale Produkte wegen der schleppenden Digitalisierung oftmals gar nicht empfangbar sind – welche Folgen sehen Sie für die Gesellschaft, deren Bevölkerung in Deutschland zu mehr als zwei Dritteln in dörflichen oder kleinstädtischen Kontexten lebt?
Je weniger Menschen sich mit einer gewissen Verlässlichkeit über die gleichen Medien – ganz gleich, ob Print oder Online, Fernsehen oder Radio – informieren, desto mehr splittert sich die Gesellschaft in ihrer politischen Urteilsbildung auf. Die Segmentierung von modernen Gesellschaften und die immer stärkere Konzentration auf einzelne Anliegen und Interessen schlagen sich längst auch in einer immer stärkeren Zersplitterung des Parteiensystems nieder.
Volksparteien sind nicht mehr attraktiv, denn deren Kerngeschäft besteht darin, nicht bestimmte Interessen zu verfolgen, sondern aus der Fülle von Einzelinteressen so etwas Ähnliches wie Gemeinwohl zu machen – zumindest etwas Mehrheitsfähiges. Damit korrespondiert im Medienbereich, dass insbesondere in der jungen Generation die großen gemeinsamen Informations- und Diskussionsquellen verschwinden, über die ein lokaler oder gesamtstaatlicher Diskurs stattfinden kann.
An deren Stelle treten eigene, subjektiv gesteuerte Informationsprozesse, zum Beispiel in Chatforen oder in den sogenannten sozialen Medien. Sich selbst miteinander vernetzende Personen tauschen sich untereinander über das aus, was sie für richtig und wichtig halten. Nach meiner Befürchtung geht das strukturell auf Kosten des Urteilsvermögens unserer Gesellschaft.
Wie weit sehen Sie den Bundestagswahlkampf als Folge dieser Entwicklung? Es wurde ja weniger über Inhalte gesprochen, sondern mehr über lückenhafte Lebensläufe oder einen Lacher an der falschen Stelle.
Dieser Wahlkampf war deutlich anders als viele Wahlkämpfe vorher. Eine Besonderheit lag darin, dass ein amtierender Regierungschef erstmals nicht zur Wiederwahl ansteht. Es war also in jedem Fall klar, dass Angela Merkel nach der Wahl nicht mehr Bundeskanzlerin sein würde. Das war die für alle erkennbare Veränderung. Damit verbunden war die genauso verbreitete gemeinsame Erwartung, dass alles andere sei wie sonst. Tatsächlich war aber fast nichts so, wie man es sich vorgestellt hatte.
Was war denn anders als sonst?
Beispielsweise fehlten die traditionellen Großkundgebungen. Sie haben für die Mobilisierung der eigenen Anhängerschaft eine enorme Bedeutung. Dann gab es Großereignisse: die anhaltende Corona-Pandemie, die unentwegten Debatten über die unterschiedlichen Maßnahmen in Bund und Ländern, die Flutkatastrophe, am Ende noch das Afghanistan-Debakel.
Welche der Themen, die die Parteien für den Wahlkampf vorbereitet hatten, spielten in der Wahrnehmung der Öffentlichkeit – verglichen mit diesen Bildern – im Wahlkampf eine dominierende Rolle? Keine. Nicht einmal das Klimathema. Anfangs wurde es in Befragungen als das meistgenannte Thema identifiziert, als das wichtigste Anliegen der Wählerschaft. Spätestens das Wahlergebnis der Grünen hat das widerlegt. Denn dass diese bei einer für sie denkbar besten Versuchsanordnung am Ende bei unter 15 Prozent landeten und damit weit unter den eigenen Erwartungen, ist ein starkes Indiz dafür, dass die vermutete Dominanz dieses Themas im Problembewusstsein der Bevölkerung bei Weitem nicht so groß ist, wie man gedacht hatte.
Warum haben die Themen fast keine Rolle gespielt? Weil die Kandidaten so sehr im Vordergrund standen?
Wir hatten eine Kandidatenkonstellation, die es in dieser Form nie gegeben hat: Erstmals gab es nicht zwei Kanzlerkandidaten, sondern drei. Bei keinem der drei deckten sich die Erwartungen von Stamm- und potenziellen Wählern mit den Erwartungen der Parteien, die sie aufgestellt hatten. Die CDU hatte das Problem, dass ein Großteil ihrer Stamm- und potenziellen Wähler gesagt hat: Normalerweise wählen wir CDU, aber diesen Kanzlerkandidaten finde ich nicht so gut. Das Problem hatten die Grünen in einer sehr ähnlichen Weise, aber zeitversetzt: Erst große Euphorie, dann zunehmende Zweifel an der Kandidatin. Und dann sagte sich ein beachtlicher Teil der Wählerschaft: Wenn ich dieses Kandidatentrio sehe, kann ich noch am ehesten Scholz wählen, dessen Partei ich aber eigentlich nicht unterstützen will.
Diesmal waren also nicht die Medien schuld...?
Ich bin sehr zögerlich, in diesem Wahlkampf einen besonderen Medieneffekt zu vermuten – außer dem zu Beginn angesprochenen. Heute kann sich jemand, der sich um ein öffentliches Amt bewirbt oder sonst irgendwie prominent ist, nirgendwo mehr unbeobachtet fühlen. Er läuft Gefahr, dass er in jeder beliebigen Situation beobachtet, dokumentiert und mit einem dann nicht mehr selbst steuerbaren Kommentar vermittelt wird.
Hätte das Angela Merkel auch passieren können?
Wenn Angela Merkel bei ihrem Besuch an der Ahr lachend geknipst worden wäre, hätte ein beachtlicher Teil des Publikums vermutlich gesagt: Warum sie lacht, weiß ich nicht, aber auf den Verdacht, sie nehme das Ereignis nicht ernst oder mache sich womöglich sogar über den Bundespräsidenten lustig, wäre kein Mensch gekommen. Da reflektiert eine positive oder negative Voreingenommenheit die Wahrnehmung eines Sachverhalts. Nachdem Laschet hinreichend häufig als ein etwas zu fröhlicher rheinischer Karnevalist vorgestellt worden war, sagten sich viele: Aha, passt! Diese Art von Kurzschlüssen gehört zu der Wirklichkeit, in der wir leben.