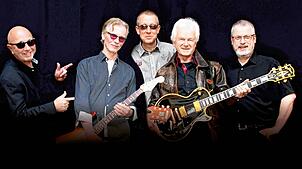Die größte Hitze ist vorüber. Als Winfried Kretschmann (Grüne) am Donnerstagvormittag auf die Terrasse tritt, weht ein kühles Lüftchen um die Villa Reitzenstein. Wolken ziehen über den grauen Himmel, hinter dem Ministerpräsidenten plätschert das Wasserspiel, zwischen den Linden spielt ein Eichhörnchen und irgendwo hämmert ein Handwerker. Auch Kretschmann (77) hat noch zu tun.
In wenigen Wochen wird er Erwin Teufel überholen und dann mit 5203 Tagen im Amt der am längsten regierende Ministerpräsident der Geschichte Baden-Württembergs sein. Gleichzeitig kommt das Ende der Legislatur in Sicht, der aufziehende Wahlkampf bringt zunehmend Sand ins Regierungsgetriebe. Zeit für ein Gespräch über den Stand der Dinge.
Herr Ministerpräsident, Sie werden demnächst länger im Amt sein als all Ihre Vorgänger. Verraten Sie uns Ihr Rezept für langes Regieren?
Winfried Kretschmann: Dafür gibt es kein Rezept. Und wenn es eines gäbe, gäbe es keine Apotheke, in der man es einlösen könnte.
Irgendetwas werden Sie richtiggemacht haben.
Kretschmann: Hoffentlich. Erstmal ist es als Politiker wichtig, verlässlich und berechenbar zu sein. Außerdem muss man immer das große Ganze im Blick haben. Ein großer Teil meiner Amtszeit fand in einem harten Krisenmodus statt. Da ist es wichtig, keine politischen Faxen zu machen.
Bleiben wir mal bei Rezepten. Gerade liegt die erste Hitzewelle des Jahres hinter uns. Wie überstehen Sie solche Tage?
Kretschmann: Ich genieße ja das Privileg, in der Regel in klimatisierten Räumen arbeiten zu können. Viele haben das nicht. Erst gestern habe ich mit meinem Sohn gesprochen, der ist Lehrer und unterrichtete zuletzt bei 32 Grad im Klassenzimmer. Das funktioniert einfach nicht, da kann man nicht wirklich lernen.
Wir mahnen ja schon lange an und arbeiten daran, dass sich Städte auf die Hitze und andere Folgen des Klimawandels vorbereiten. Aber ich kann mich gut erinnern, wie eine wichtige Partei in Baden-Württemberg sich lustig gemacht hat, als wir uns für Fassadenbegrünung eingesetzt haben.
Auch die Koalition ist beim Thema Klimaschutz uneins. Ausgerechnet jetzt kassiert die grün geführte Landesregierung ihre Klimaziele. Warum?
Kretschmann: Davon kann überhaupt keine Rede sein! Klimaschutz gehört zu meinen Kernleidenschaften, wir sind hier sehr erfolgreich. Seit 2010 haben wir den Ausstoß von Klimagasen um 20 Prozent reduziert.
Aber Ihre selbst gesetzten Klimaziele drohen Sie zu verfehlen und können sich in der Koalition nicht auf strengere Maßnahmen einigen.
Kretschmann: Wir erfüllen die Klimaziele, die in unserer Hand liegen, weitestgehend. Letztlich sind das gegriffene Zahlen und Termine. Ob Baden-Württemberg zu irgendeinem Stichtag irgendwelche Werte erreicht, hat auf das Weltklima kaum Auswirkungen. Entscheidend ist, dass wir zeigen, dass wir ernsthaften Klimaschutz machen und dabei ökonomisch erfolgreich sind.

Dann muss man sich also keine Klimaziele setzen?
Kretschmann: Natürlich muss man sich Ziele setzen. Aber es wäre aberwitzig, zu glauben, man könne alle Ziele, die man sich setzt, immer genau erreichen. Das ergibt keinen Sinn und führt nur zu Konflikten, die nicht produktiv sind. Besser wäre es, wenn man künftig Korridore benennt.
Wie meinen Sie das?
Kretschmann: Sich Ziele zu setzen, ist wichtig. Aber man muss eine gewisse Schwankungsbreite einkalkulieren. Es ist ja nicht so, dass Wissenschaftler sagen: Es ist bei maximalen Anstrengungen möglich, im dritten Quartal 2040 klimaneutral zu werden und deshalb schreiben wir das ins Gesetz.
Sondern das war eine politische Ansage, dass wir so ambitioniert wie möglich vorangehen wollen. Ob man dieses Ziel dann erst 2041 oder sogar schon 2039 erreicht, ist nicht entscheidend. Daher wäre es politisch vernünftiger, Korridore anzugeben.
Weil man Regierungen dann nicht an Zielen messen kann?
Kretschmann: Darum geht es doch gar nicht. Das Ziel der Klimaneutralität bleibt. Man kann aber nicht eine Präzision erwarten, die weder berechenbar noch erfüllbar ist. Es geht doch darum, die Klimakrise real zu bekämpfen. Und da sind wir in Baden-Württemberg außerordentlich erfolgreich. Denken Sie mal an den Solarboom, den wir ausgelöst haben.
Ähnlich routiniert wie die Erderwärmung nimmt die Öffentlichkeit die Bildungskrise zur Kenntnis. Zuletzt ergab eine Studie, dass 50 Prozent der Grundschüler die Mindeststandards in Rechtschreibung nicht erreichen. Warum haben Sie da in fast fünfzehn Jahren Regierungszeit keine Besserung erreicht?
Kretschmann: Solche Trends sind beklemmend, aber leider nicht neu. Wir haben auf diese Entwicklungen bereits mit einer großen Schulreform reagiert. Wir konzentrieren uns auf die frühkindliche Bildung und haben ein riesiges Paket zur Sprachförderung aufgelegt. Aber Schulreformen wirken nun mal nicht von heute auf morgen und nicht losgelöst von gesamtgesellschaftlichen Entwicklungen.

Ihre Kultusministerin, Theresa Schopper, hat vergangenes Jahr wegen steigender Schülerzahlen etliche neue Lehrerstellen gefordert. Warum hat sie die nicht bekommen?
Kretschmann: Wir haben einen absoluten Schwerpunkt in der Schulpolitik gesetzt und investieren mittlere dreistellige Millionenbeträge. Übrigens: Wir haben fast 30 Prozent mehr Lehrer als vor 50 Jahren – und weniger Schüler. Dazu kommen noch Sozialarbeiter und Ehrenamtliche. Das zeigt doch, dass man allein durch mehr Lehrer das Problem nicht löst.
Sind Sie insgesamt zufrieden mit Ihrer Schulpolitik?
Kretschmann: Natürlich bin ich mit der Gesamtentwicklung unzufrieden. Aber die ist einfach keine unmittelbare Folge unserer Politik. Diese Entwicklungen sieht man überall in Europa. Migration spielt natürlich eine große Rolle, Lehrermangel, neue Medien und damit einhergehende Ablenkungen für Kinder, die Erziehungspartnerschaft zwischen Eltern und Staat funktioniert nicht mehr wie früher, und vieles mehr.
Aber ich bin auch zufrieden, dass das zuletzt mit der Schulreform geklappt hat. Davon stand kein Wort im Koalitionsvertrag. Trotzdem haben sich Grüne und CDU, die bildungspolitisch ganz unterschiedlich ticken, angesichts drängender Probleme geeinigt.
Sie lagen gelegentlich auf Konfliktlinie mit dem Kurs Ihrer Partei. Wie übersteht man diesen Dauerkonflikt mit der Partei so lange?
Kretschmann: Wie kommen Sie denn darauf?
Etwa beim Migrationskurs, da verfolgen die Grünen klar einen anderen Kurs als Sie.
Kretschmann: Das stimmt, beim Migrationskurs gab es von Anfang an einen Grundkonflikt mit der Bundespartei. Aber ich bin nicht Ministerpräsident der Grünen, ich bin Ministerpräsident von Baden-Württemberg. Keiner wird Ministerpräsident, der nicht mehrheitsfähige Antworten geben und Mehrheiten organisieren kann.
Sie sind 2011 für einen neuen Politikstil angetreten. Wie oft mussten Sie Ihren moralischen Kompass seither neu ausrichten?
Kretschmann: Einen moralischen Kompass sollte jeder Politiker haben. Aber die Moralisierung politischer Alltagsfragen halte ich für höchst problematisch. Das führt nur zu Kulturkämpfen. Meine große Überschrift war die Politik des Gehörtwerdens. Das ist etwas ganz Anderes.
2026 geht mit der Landtagswahl Ihre Amtszeit zu Ende. Auch viele Ihrer Weggefährten verlassen die aktive Politik. Was soll von Ihrer Ära bleiben?
Kretschmann: Unter diesen Kategorien führe ich mein Amt nicht. Wir arbeiten bis zum Wahlabend an den großen Überschriften: dass wir eine gefestigte Demokratie sind, dass wir unsere Lebensgrundlagen bewahren und nicht zerstören und dass Baden-Württemberg bürgerschaftlich engagiert und innovativ bleibt. Mit dem Charme, das Land der Tüftler und Schaffer zu sein.
Hinter all das muss man doch aktuell Fragezeichen setzen.
Kretschmann: Wir sind von Fragezeichen umgeben. Es herrscht Krieg in Europa. Weltweit geraten Demokratien massiv unter Druck. Der Klimawandel zeigt jetzt wirklich sein hartes Gesicht. Das spüren wir. Und da muss man sich Sorgen machen. Aber ich bin zuversichtlich.
Was macht Ihnen Hoffnung?
Kretschmann: Die Menschen sind auch kreativ und haben eine sehr gute Seite: Sie können kooperieren. Und wenn sie sich hinter einer Idee versammeln, gemeinsam handeln, dann können sie, um meine Mentorin Hannah Arendt zu zitieren, Wunder bewirken.
Insofern ist Zuversicht angebracht. Immer, wenn ich in diesem Land unterwegs war, habe ich Leute getroffen, die etwas auf die Beine stellen. Das wird mir bleiben: das große Geschenk, Regierungschef in so einem Land gewesen zu sein.