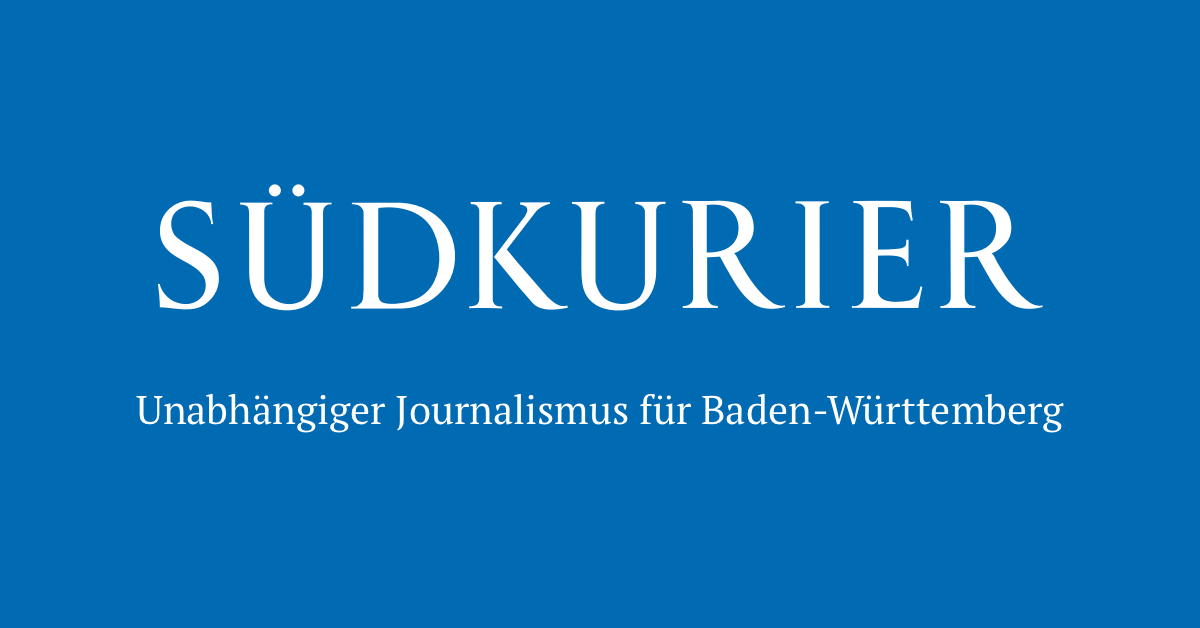Olaf Scholz hat in Washington nicht alle Zweifel ausgeräumt, die er hätte ausräumen müssen. Im Ukraine-Konflikt gelten die Deutschen als unsichere Kantonisten, die klammheimlich mit Russland liebäugeln: Dieser Eindruck hat sich bis nach Amerika herumgesprochen. Alles falsch, versicherte der Kanzler dem amerikanischen Präsidenten. Ganz überzeugen konnte er ihn wohl nicht. Denn Scholz hütete sich, den Preis zu beziffern, den Deutschland zahlt, wenn es im Osten Europas zum Ernstfall kommen sollte. Und so übernahm der Gastgeber diesen Part. Sollte Putins Armee ins Nachbarland einmarschieren, hat sich das Gasprojekt Nord Stream 2 erledigt – sagt Joe Biden, nicht etwa der deutsche Bundeskanzler. Wo eine Klarstellung fällig ist, überlässt Scholz anderen das Wort.
Mit Schweigen, Wegducken und Herumdrucksen wird sich die Bundesregierung nicht durch die größte außenpolitische Krise der vergangenen Jahrzehnte lavieren können. Was die russische Führung an der Grenze zur Ukraine inszeniert, verlangt nach einer unmissverständlichen und sorgfältig abgestimmten Antwort des Westens. Bleibt sie aus, kann sich der Kreml nur ermutigt sehen, seine großrussischen Träume von alter Größe und Herrlichkeit mit militärischer Gewalt zu verwirklichen. Frieden und Stabilität im Osten Europas wären dann endgültig dahin, so fürchten es zumindest die EU-Partner in Russlands Nachbarschaft.
Deutschland hat zu dieser Antwort bisher wenig beigetragen. Am deutlichsten werden die Defizite in der Diskussion um Waffenlieferungen. Die Ukraine ruft nach Abwehrwaffen, die Bundesregierung schüttelt den Kopf. Mehr als 5000 Armeehelme und ein Feldlazarett sind nicht drin. Da hätten die Deutschen auch gleich Kopfkissen schicken können, sagt der Bürgermeister von Kiew, Vitali Klitschko. Man kann es ihm nachfühlen.
Die politische Sprengkraft dieser Auseinandersetzung liegt auf der Hand: Bei Waffenlieferungen geht es immer auch um Glaubwürdigkeit. Die Bundesrepublik gehört zu den größten Rüstungsexporteuren der Welt, sie liefert Panzer, Kriegsschiffe und Geschütze nach Ägypten und Nahost. Und da kommen plötzlich moralische Bedenken, wenn es um die Frage geht, wie für Putin der Preis eines Angriffs hochgeschraubt werden kann? Tatsache ist: Die Ampel-Parteien haben in ihrem Koalitionsvertrag Waffenlieferungen in Krisengebiete ausgeschlossen – ein Kompromiss, auf den sich heute vor allem die SPD beruft. Nirgendwo sind Strafmaßnahmen gegen Moskau unpopulärer als in den Reihen der Sozialdemokraten, wo ein früherer Kanzler Täter und Opfer verwechselt und unverblümt Stimmung gegen die Ukraine macht. Putin-Freund Gerhard Schröder ist zwar nicht mehr Bundeskanzler, doch seine Strippenzieherei hinter den Kulissen zeigt in erschreckendem Ausmaß, wie groß sein Einfluss auf die Partei noch ist, wenn es um Russland geht.
Und was nun? Frieren für Kiew?
Die neue Bundesregierung muss in der Ukraine-Krise daher erst einmal ihre Rolle finden. Ein Ja zu Waffenlieferungen ist keineswegs zwangsläufig, denn Rüstungshilfe kann in Konflikten immer nur das letzte Mittel sein, wenn alle anderen Versuche der Friedenssicherung scheitern sollten. So weit ist es in der Ukraine noch nicht.
Die Bundesregierung sollte aber klarstellen, was sie stattdessen liefert. Joe Biden hat die Antwort vorweggenommen: Wenn Deutschland nicht militärisch Druck machen will, dann macht es ihn eben wirtschaftlich. Als einer der größten Abnehmer für die russische Gas- und Ölindustrie sitzt die Bundesregierung an seinem sehr langen Hebel. Aber Sanktionen schneiden immer auch ins eigene Fleisch. Scholz weiß, was das in einer Phase gewaltiger Preiserhöhungen für Industrie und Bevölkerung im eigenen Land bedeuten könnte. Frieren für Kiew? Die Frage ist nicht bequemer als die Frage nach Waffenlieferungen. Kein Wunder, dass der Kanzler lieber schweigt.