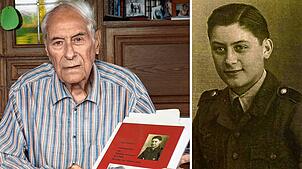Frau Barley, der Atomschirm wäre unter einem US-Präsidenten Trump nicht mehr sicher, haben Sie kürzlich gesagt – und damit Bestürzung in der deutschen Politiklandschaft ausgelöst. Hat Sie das überrascht?
Ich habe gesagt, dass die nukleare Teilhabe in Zukunft zu einem Thema werden kann. Ich wünsche mir, dass wir innerhalb der Nato Seite an Seite mit unseren Partnern auch weiterhin dieses Element unser Sicherheitsarchitektur organisieren. Fest steht: Wir Europäer müssen innerhalb des Bündnisses mehr Verantwortung übernehmen. Wir sind auf einem guten Weg. Wir investieren in eine europäische Luftabwehr und mit Finnland und bald Schweden treten zwei weitere europäische Länder der Nato bei. Wir wollen die europäische Säule innerhalb der Nato stärken.
Eine EU-Atombombe kann also Thema werden? Macht das die Welt nicht noch unsicherer, als sie es jetzt schon ist?
Mir ist sehr wichtig, dass Europa eine Friedensunion bleibt, sowohl nach innen wie nach außen. Aber wir müssen damit umgehen, dass andere militärische Mittel androhen, um ihre Interessen durchzusetzen. Leider leben wir noch in keiner atomwaffenfreien Welt, deshalb ist die nukleare Teilhabe in der Nato wichtiger Bestandteil der europäischen Sicherheitsarchitektur. Mehr solcher Waffen sind definitiv nicht mein Ziel.
Als Spitzenkandidatin der SPD treten Sie bei der Europawahl für eine Partei an, die gerade mal bei 16 Prozent steht. Beunruhigt Sie das nicht?
Wissen Sie, was mich total ermutigt? Das sind die vielen Menschen, die jetzt auf die Straße gehen. Dass sich mehr Menschen bewusstmachen, wie wertvoll die Demokratie ist und zur Wahl gehen werden. Europawahlen waren öfter Wahlen, bei denen die Beteiligung nicht so hoch ist. Das wird dieses Mal hoffentlich anders sein.
Sie waren schon beim letzten Mal Spitzenkandidatin, als die SPD mehr als elf Prozent an Zustimmung verlor. Das muss doch Narben hinterlassen haben.
Natürlich hätte ich mir ein anderes Ergebnis gewünscht. Aber ich habe in meinem Leben immer so gelebt, dass ich in die Aufgabe, die ich vor mir habe, alles lege, was ich habe. Das habe ich auch damals gemacht. Allerdings waren die Umstände nicht so gut.
Und heute?
Heute sehen die Menschen stärker als früher, dass Europa eigene Themen hat, auch wenn vieles mit nationalen Themen und Akteuren zusammenhängt. Pandemie, Energie, Digitalisierung, der russische Krieg in der Ukraine, Klimaschutz – das alles sind Dinge, die man sinnvollerweise nicht mehr alleine regeln kann.
Sie haben es angesprochen: Viele Menschen gehen in diesen Tagen auf die Straße. Auf der anderen Seite gibt viel Wut im Land. Die Europawahl droht damit zur großen Abstrafwahl zu werden. Ist Europa bedroht?
Europa ist bedroht – durch Feinde von außen und von innen. Es gibt viele Kräfte außerhalb der Europäischen Union, die überhaupt kein Interesse an einer starken EU haben. Donald Trump zum Beispiel. Wir erleben außerdem, in welchem Umfang Russland Desinformation gestreut hat, um die Politik der Regierung schlecht zu machen. Und daneben gibt es die, die die EU von innen schwächen wollen: Die Rechtsradikalen, die radikalen Nationalisten, die Faschisten, die Regierungen unterstützen oder schon in den Regierungen sind. Schweden gehört dazu, Finnland, Italien, vielleicht bald die Niederlande. Insofern steht unheimlich viel auf dem Spiel.
Wie sieht denn die politische Zusammenarbeit mit den Rechten auf EU-Ebene aus?
Von Zusammenarbeit kann man nicht sprechen. Wir haben zwei Rechtsaußen-Fraktionen im Europaparlament, eine ist rechtspopulistisch, die andere rechtsextrem. Beide sind sich untereinander nicht grün, weil sie ein unterschiedliches Verhältnis zu Russland haben. Da kommen zum Beispiel die polnische Pis-Partei und die deutsche AfD überhaupt nicht zusammen. Der Wind im Europaparlament ist insgesamt noch rauer. Die Rechten sagen teilweise noch deutlicher, was sie meinen.
Haben Sie dafür ein Beispiel?
Als eine spanische Delegation angeführt von Pedro Sanchez zuletzt das Parlament betrat, hat ein spanischer Rechter sie lauthals als Hurensöhne beschimpft. Aber auch andere vergreifen sich im Ton. Im Dezember hat eine irische Abgeordnete der Linken die Kommissionspräsidentin im Zuge des Kriegs in Gaza als „Frau Genocide“ betitelt. Solche Sachen müssen geahndet werden.
Vertreter der AfD suchen die ideologische Nähe zu Viktor Orban. Der Ungar und sein Staatsumbau sind den Sozialdemokraten schon immer ein Dorn im Auge...
Ja, auch mir ganz persönlich.
Sie forderten kürzlich einen Stimmrechtsentzug für diese ungarische Regierung. Ist das überhaupt rechtens?
Wir haben den Artikel 7 in den Europäischen Verträgen. Absatz 1 dieses Artikels wird bereits gegen Ungarn, und auch gegen Polen angewandt. Dabei soll festgestellt werden, ob die jeweilige Regierung schwerwiegend gegen den Rechtsstaat verstoßen haben. Absatz 2 des Artikels sieht mögliche Sanktionen vor – die schwerste davon ist der Stimmrechtsentzug. Das ist natürlich etwas, das man nicht leichtfertig fordert.

Was spricht dafür?
Orban zerstört seit 2010 die Demokratie in seinem Land – seit er zum zweiten Mal Premierminister geworden ist. Lange tat er das auch unter dem Schirm der Konservativen, die ihn gedeckt haben. Orban hat heute das ganze Land in der Hand. Alle staatlichen Gewalten, die Verwaltung, das Parlament, die Justiz, aber auch die Medien, die Kultur und die Wissenschaft. Er hat an etwa 700 Stellen Änderungen am Wahlrecht unternommen. Im Grunde kann er Wahlen gar nicht mehr verlieren.
Sollte er die Wahl doch verlieren, behält er trotzdem alles in der Hand, weil fast alle Änderungen nur mit einer Zwei-Drittel-Mehrheit rückgängig gemacht werden können. Orban hat jetzt außerdem ganz legal die Möglichkeit, eine neue Regierung zu stürzen. Das hat mit Herrschaft auf Zeit nichts mehr zu tun, das ist eine einbetonierte Autokratie. Das gipfelt darin, dass er seit vielen Jahren öffentliche Gelder in Milliardenhöhe in die Taschen seines Schwiegersohns, seines Vaters und seines besten Freundes, eines Klempners, steckt.
Wie kann so jemand noch Mitglied in der Wertegemeinschaft EU sein?
Viele Jahre war er Teil der konservativen Parteienfamilie und die haben ihn gedeckt. Dazu kommt, dass die Europäischen Verträge den Ausschluss eines Landes nicht vorsehen. Ich würde das Land auch nicht ausschließen. Es hat eine gewählte Regierung. Wenn man sich die Medienlandschaft in Ungarn anschaut, muss man das fast als Gehirnwäsche bezeichnen. Es gibt keinen einzigen Radiosender mehr, der nicht Regierungsfunk ist. Sie werden im staatlichen Fernsehen nur Orban-Propaganda hören. Nur ganz wenige Zeitungen sind nicht regierungshörig. Vor einiger Zeit gab es mal eine Umfrage unter den Anhängern seiner Fidesz-Partei zur Frage, wer schuld am Krieg in der Ukraine ist. Die Nato, die USA, die Europäische Union, die Ukraine oder Russland. Wissen Sie, wie viele Leute „Russland“ gesagt haben?
Sie werden es mir bestimmt gleich sagen.
Vier Prozent. Das ist absurd und das Resultat staatlicher Propaganda. Aber die Ungarn selbst, gerade die Jungen, sind sehr europafreundlich. Deshalb ist es richtig, die Ungarn nicht zu verlieren, auch wenn die Regierung rechtsstaatswidrig agiert. Bei den Polen hat man es ja gesehen: Die haben ihre autokratische Regierung am Ende in die Wüste geschickt.
Ungarns Veto hat lange Zeit EU-Milliarden für die Ukraine blockiert. Beim EU-Sondergipfel in Brüssel gab Orban dann überraschend nach. Wie kam das?
Ich bin enorm stolz auf unseren Bundeskanzler. Olaf Scholz hat alle bei der Stange gehalten und schon beim ersten Mal den Kniff gefunden: Viktor, geh mal aufs Klo. Dieses Mal hat Olaf Scholz vorab ein deutliches Machtwort gesprochen, es hat geholfen.
Ein kleines Zugeständnis an Orban gab es doch aber: Die anderen 26 Länder räumten die Möglichkeit ein, nach zwei Jahren erneut auf Chefebene über die Ukraine-Hilfen zu diskutieren. Ist man damit nicht wieder auf die Bedürfnisse Ungarns eingegangen?
Diskutieren ja, Abstimmen nein. Das ist genau der Punkt. Orban wollte eigentlich jedes Jahr wieder darüber abstimmen. Er würde also jedes Jahr wieder die Hand aufmachen und absurde Forderungen stellen. Jetzt werden aber die Ukraine-Hilfen nach zwei Jahren überprüft. Das kann in die eine, aber auch in die andere Richtung gehen. Es könnte also auch heißen: Wir brauchen noch mehr Unterstützung für die Ukraine. Es wird nun ausdrücklich nicht mehr darüber abgestimmt. Orban hat in dieser Sache kein Veto-Recht.
Sind Sie Orban denn schon mal begegnet?
Noch nicht, obwohl ich zu seinen Lieblingsfeindinnen gehöre. Er hat mich schon mal neben Adolf Hitler plakatieren lassen; die Fidesz-Spitzenkandidatin arbeitet sich auch gerne an mir ab.
Sind Sie gegen die Hitler-Plakate vorgegangen?
Nein, wenn mich jemand wie Viktor Orban so heftig bekämpft, nehme ich das als Auszeichnung.
Die Rechtspopulisten steigen an vielen Stellen in Europa auf – in Italien, Österreich, Frankreich, den Niederlanden, der Slowakei. Haben Sie eine Idee, woher der kommt?
Man darf das nicht zu klein betrachten, weil es in vielen, sehr unterschiedlichen Ländern passiert. Nur zu sagen, die Leute fühlen sich allein gelassen mit einem bestimmten Thema, mit sozialen Fragen, der Inflation oder der Migration, greift zu kurz. Es hat eher mit einer allgemeinen Verunsicherung zu tun. Mit dem Klimawandel, der Digitalisierung etwa und damit einhergehend auch mit dem Gefühl, dass man zu den Verlierern gehören könnte, was gar nicht nur finanziell gemeint ist.
Man sieht in diesen Autokratien zum Beispiel, dass es dort früher oder später immer um die Rechte von Frauen geht. Das sind Männer, die patriarchal aufgewachsen sind und den Eindruck haben, dass Frauen sich nicht länger unterordnen wollen. Deshalb ist es auch kein Wunder, dass diese ganzen Fragen des Genderns und der Identitäten von diesen Leuten so hochgezogen werden. Für die sind das Triggerpunkte, diese Wut wollen sie entfachen. Dazu kommen die sozialen Netzwerke, alles spielt ineinander.
Der Faktor Migration dürfte dennoch einen großen Anteil an dieser Verunsicherung tragen. Haben die Sozialdemokraten das unterschätzt?
Es geht um alle demokratischen Parteien, weil Migration offensichtlich das Thema ist, mit dem man an die tiefsten, niedersten Beweggründe gehen kann. Allein wenn man bedenkt, was der Satz „Wir sind ein Einwanderungsland“ für Diskussionen ausgelöst hat. Dabei liegt Deutschland mitten in Europa. Wir sind geografisch immer Einwanderungsland gewesen.
Sehr viele Menschen in Deutschland – wenn man zwei, drei Generationen zurückgeht – haben irgendwo jemanden aus Frankreich, Polen, den USA oder woher auch immer in der Familie. Gleichzeitig muss man die Probleme, die es gibt, offen benennen. Wir beschließen gerade ein neues Gesetz auf EU-Ebene zum Thema Asyl. Die bisherigen Regeln funktionieren nicht, weil sich keiner an sie hält. Deshalb brauchen wir neue Regeln und rechtsstaatliche Verfahren, um die durchzusetzen.
Noch ist aus dem Asylpaket kein Gesetz geworden. Gelingt das noch vor der Europawahl?
Ganz sicher weiß man das erst, wenn die Verhandlungen abgeschlossen sind. Aber es sieht so aus, als würde es zu einer Einigung kommen. Die wesentlichen Eckpunkte stehen ja bereits, jetzt geht es nur noch um Details. Bis die Maßnahmen greifen, wird es aber noch dauern.
Bis zur Wahl sind es nur noch wenige Monate. Es zeichnet sich ab, dass Ursula von der Leyen eine zweite Amtszeit anstrebt. Gleichzeitig will sie den Wahlkampf umgehen. Wie finden Sie das?
Ich begegne vielen Menschen, die sagen, dass das schon beim ersten Mal nicht okay war. Sie sollte sich dieses Mal den Bürgerinnen und Bürgern in einem richtigen Wahlkampf stellen.
Wie erleben Sie von der Leyen?
Ich kenne sie schon lange. Wir haben zusammen auf der Regierungsbank gesessen, sogar nebeneinander. Sie ist Europäerin und natürlich überzeugte Demokratin.
Das befähigt sie aber noch nicht zur kompetenten EU-Kommissionspräsidentin.
Da gibt es Licht und Schatten.
Welchen Schattenseiten meinen Sie?
Da sind wir wieder bei den Autokraten. Sie brauchte bei ihrer ersten Wahl deren Stimmen. Später hat sie die Autokraten einfach viel zu lang weitermachen lassen und ist erst viel zu spät und viel zu zaghaft eingeschritten. Jetzt musste Olaf Scholz dem einen Riegel vorschieben. In diese Situation hätten wir erst gar nicht erst kommen dürfen.