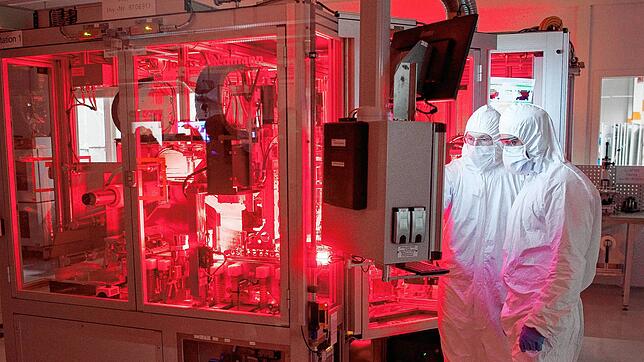Herr Fichtner, erste Elektroautos gab es schon vor über 100 Jahren. Warum springen die deutschen Autohersteller erst jetzt auf den Zug?
Die Politik hatte jahrelang versucht, die Automobilindustrie dazu zu bewegen, in die Batterietechnik einzusteigen. Dort hat man sich zuerst lange geziert und gesagt, Batterien sind kein Kerngeschäft für einen Automobilhersteller. Bis dann Firmen wie Tesla oder die Chinesen einfach gezeigt haben, wenn man das Batterie-Know-how hat und die Batterien auch designen kann für das eigene Fahrzeug, bekommt man einen großen Entwicklungsvorsprung.
Das hat letzten Endes dazu geführt, dass die riesigen Förderprogramme zur Motivierung der Industrie nahezu obsolet geworden sind, denn Deutschland hat sich mittlerweile vom Skeptiker zum Boomland entwickelt. Und das ist industrie-, nicht politikgetrieben. Es gibt kein Land in Europa, in dem im Augenblick so viele Batteriezellfabriken aufgebaut werden wie in Deutschland.

Hält die Technik ihre Versprechen?
Die Speicherkapazität hat sich seit Einführung der Lithium-Ionen-Batterie praktisch vervierfacht und die Kosten sind um den Faktor 18 gesunken, alleine in den letzten zehn Jahren sanken die Kosten um 90 Prozent. Es gab in Deutschland seit den 2000er Jahren zunehmende Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten. Und ab einem gewissen Punkt ist die Industrie massiv aufgesprungen, da man mit der Batterie immer mehr Anwendungen versorgen kann, insbesondere in der Elektromobilität oder bei stationären Energiespeichern.

Der E-Autoboom hängt aber noch am Tropf der Subventionen. Wann sind E-Autos so günstig wie Verbrenner?
Was kostet der ID.3 von Volkswagen? Etwa 32.000 Euro, nach Abzug der Prämie etwa 23.000 Euro, und der Ioniq 5 kostet 30.000 Euro minus der Prämie. Was kostet ein Golf? Etwa 27.000 Euro in der Grundversion, da ist kein großer Unterschied mehr. Es gibt natürlich Oberklassemodelle, die liegen in der Gegend eines Verbrenner-Sportwagens, aber die meisten E-Fahrzeuge kriegen sie unter 40.000 Euro, natürlich je nach Ausstattung. Der Hauptkostenfaktor ist dabei die Batterie, die macht etwa ein Drittel vom Kaufpreis aus. Aber die Batterie befindet sich immer noch auf einer sinkenden Kostenkurve.
Neue Entwicklungen machen die Batteriefertigung noch deutlich einfacher und effizienter. Tesla hat jetzt angekündigt, 2022 den Nachfolger des Modell 3 rauszubringen – für 25.000 Dollar. Das sind etwa 20.000 Euro, plus Mehrwertsteuer sind es 24.000, minus Förderung 15.000 Euro. Das ist dann deutlich unter einem gleichwertigen Verbrenner. Die Kostenkurven, die auf der E-Mobilität liegen, auch die Entwicklungskurven, was die Leistungsfähigkeit der Batterien angeht – das finden Sie derzeit in keiner anderen Technik.
Die Begeisterung für das E-Auto könnte aber abkühlen, wenn man in den Urlaub aufbricht und unterwegs keine Ladesäule findet …
Die Ladeinfrastruktur muss immer noch ausgebaut werden, das ist keine Frage. Sie wird allerdings auch ausgebaut. Letztes Jahr hatten wir 15.000 Ladesäulen, jetzt sind wir bei 25.000. Tatsächlich ist es derzeit so, dass die Zunahme der Elektrofahrzeuge den Ausbau der Ladeinfrastruktur übersteigt. Seit letzten Mai gab es eine Zunahme von 380 Prozent bei den Elektrofahrzeugen – und 37 Prozent bei den Verbrennern.
Im Augenblick haben wir noch vergleichsweise wenig Fahrzeuge und sie kriegen praktisch überall eine freie Säule. Entscheidend ist, dass man, wenn man große Strecken fahren will, Supercharger an der Strecke hat. Aber die gibt es mittlerweile überall, auch in Frankreich oder Spanien, wo gerade ein riesiges Netz aufgebaut wird. Selbst die normalen Tankstellen bauen jetzt Schnelllader hinzu. Das Problem ist eher, wenn man in bestimmten Bereichen unterwegs ist, wo die Ladesäuleninfrastruktur eher der Netzabdeckung der Deutschen Telekom ähnelt. Für das eigene Auto haben die Leute auf dem Land in der Regel eine Garage, da können sie eine Wallbox installieren und aufladen. Problematischer ist es eher in den Städten, da muss zugebaut werden.

Vor kurzem wurde das Lieferkettengesetz beschlossen. Wie passt das zum Batterieboom, wenn Kobalt mit Kinderarbeit im Kongo gewonnen wird?
Dieses Thema ist die Wissenschaft schon relativ früh angegangen. Wenn Sie sich die allerersten Lithium-Ionen-Batterien ansehen, die hatten im Pluspol quasi 100 Prozent Kobaltoxid. Dann hat man schon in den 90er Jahren festgestellt, Kobalt ist selten, Kobalt ist teuer, Kobalt ist giftig. Deshalb liefen schon früh Anstrengungen, Kobalt zu ersetzen. Etwa um das Jahr 2000 hat man es geschafft, den Kobaltgehalt auf ein Drittel zu reduzieren. Dann waren es 20 Prozent, dann zehn Prozent. Im Augenblick sind es bei Tesla 2,8 Prozent.
Und jetzt sind schon die ersten Fahrzeuge auf der Straße, in deren Batterien überhaupt kein Kobalt mehr enthalten ist, die fahren mit Eisenphosphat im Pluspol. Das haben die Chinesen angefangen, VW übernimmt das jetzt, auch Renault. Tesla hat in Shanghai schon ein kobaltfreies Modell auf dem Markt. Das Thema Kobalt ist in absehbarer Zeit Geschichte. Kobalt ist zwar noch in derzeitigen Autobatterien drin, aber von dem ganzen Kobalt, das gefördert wird, gehen nur acht bis zehn Prozent in Batterien von E-Autos.
Lässt sich Kobalt aus alten Batterien wiedergewinnen?
Im Augenblick leiden die Recycler noch darunter, dass zu wenig Batterien ankommen. Bei Handys und Notebooks gibt es ohnehin keine Verpflichtung, die liegen in irgendeiner Schreibtischschublade herum, das hat jeder, ich auch. Wenn Sie heute ein E-Auto mit einer großen Batterie kaufen, dann ist die vielleicht in 15 bis 18 Jahren so weit, dass sie ins Recycling kommt. Das heißt, der große Run kommt, aber er kommt erst nach 2030.
Im Augenblick versuchen die ganzen zukünftigen Recycler, ihre Prozesse zu entwickeln und sich in Startposition zu bringen, aber es gibt einfach noch zu wenige Batterien, die zum Recycling kommen, als dass dieser Rückfluss von Material eine große Rolle spielen würde. Generell ist man mittlerweile so weit, dass man etwa 95 Prozent einer Batterie recyceln kann.
Wird das Wasserstoffauto ein Exot bleiben?
Im Pkw-Bereich hat der Wasserstoff wenig Chancen. Honda hat jetzt seine Wasserstofffahrzeuge vom Markt genommen, jetzt gibt es nur noch zwei Hersteller, Toyota und Hyundai. Wenn sie einen Hyundai Nexo kaufen, kostet der 70.000 Euro. Hyundai selber kostet er in der Produktion 110.000 Euro. Das ist alles viel zu teuer. Zudem müssten sie in der ganzen Erzeugungs-, Verteilungs- und Verwertungskette des Wasserstoffs überall um den Faktor drei runter mit den Kosten. Ich habe selbst zwölf Jahre in der Entwicklung von Wasserstoffantrieben gearbeitet. Ich habe gesehen, was sich in den letzten zehn Jahren getan hat, es ist nicht viel.