Mit hohem Tempo setzt die Politik den Unternehmen neue Ziele in Sachen Klimaschutz. Im April kassierte das Bundesverfassungsgericht das Klimaschutzgesetz, weil es das „Recht auf Zukunft“ folgender Generationen beeinträchtige. Gleichzeitig mahnten die Karlsruher Richter zügigere Schritte gegen die Klimaerwärmung an. Die kamen prompt. Im Juni trat der neue verschärfte Klimafahrplan für Deutschland in Kraft. Klimaneutralität soll demnach bereits 2045 erreicht werden und nicht wie bislang geplant 2050. Dazu nötig ist, dass der Ausstoß des Klimagases CO2 deutlich schneller sinkt. Um 65 Prozent statt der bisher angepeilten 55 Prozent im Vergleich zu 1990. Von einer „nie dagewesenen Geschwindigkeit“ spricht der Chef des deutschen Industrie-Dachverbands BDI, Siegfried Russwurm, mit Blick auf die neue Umweltgesetzgebung.
EU will Verbrenner-Verbot ab 2035
Und dann gibt es ja noch die Europäische Union (EU). Sie präsentierte Mitte Juli ihre Pläne für einen klimaneutralen Kontinent. Bis 2030 soll der CO2-Ausstoß zwischen Helsinki und Cadiz um 55 Prozent sinken. Dafür sollen Milliarden investiert, der CO2-Ausstoß auf breiter Front mit Abgaben belegt und ein neues Zoll-Regime für Klimasünder an den EU-Außengrenzen aufgebaut werden. Autos dürfen nach Willen der EU ab 2035 nur noch neu zugelassen werden, wenn sie kein CO2 mehr ausstoßen, was einem Verbot des Verbrennungsmotors gleichkommt. Es geht ziemlich schnell dieser Tage in Europa.
Klar ist: Die Klimakrise ist da und kommt härter als befürchtet, wie internationale Forscher des Weltklimarats IPCC gestern in ihrem neuen Sachstandsbericht betont haben. Aber können die Unternehmen angesichts der bereits eingeleiteten Maßnahmen überhaupt Schritt halten?
Doping für das E-Auto? Der Verbands-Chef mahnt die Politik
Auf die Automobilbranche komme in Sachen Umweltgesetzgebung einiges zu, sagt Christoph Münzer, Hauptgeschäftsführer des Freiburger Industrieverbands WVIB, in dessen Einzugsgebiet rund 350 Automobilzulieferer mit 190.000 Beschäftigten ansässig sind. Konkret bedeutet das: Hersteller von Motorenteilen wie Kolben oder Abgasanlagen, werden sich ganz neue Geschäftsfelder suchen müssen. Ganze Belegschaften müssen umlernen, oder sie laufen Gefahr, ihre Jobs zu verlieren.

Wie viele andere Industrievertreter fordert Münzer von der Politik daher einen Klimakurs, der sich an technologischer Offenheit orientiert, anstatt bestimmte Innovationen wie etwa batterieelektrisches Fahren als alternativlos darzustellen. Gerade beim Thema Antriebe sei eine „ehrliche Klimarechnung nötig“, sagt Münzer. Würde die komplette Wertschöpfungskette und Lebensdauer berücksichtigt, komme der viel gescholtene Dieselantrieb „gar nicht so schlecht weg“. Ein E-Auto von Tesla trage andererseits einen gehörigen CO2-Rucksack mit sich herum. „Wir werfen Brüssel vor, den Sieger im Klimarennen schon definiert zu haben, bevor der Wettkampf überhaupt begonnen hat“, sagt Münzer.
Aber was sagen eigentlich Unternehmens-Chefs aus der Region zu alldem? Fürchten sie angesichts der Tatsache, dass CO2 hierzulande einen Preis erhält, anderswo aber nicht, um ihre Wettbewerbsfähigkeit? Gehen sie auf Konfrontationskurs zur Regierungspolitik oder versuchen sie, die „neue industrielle Revolution“, wie Bundesumweltministerin Svenja Schulze (SPD) den Umbruch genannt hat, zu gestalten? Der SÜDKURIER hat mit ihnen gesprochen. Ein Überblick:
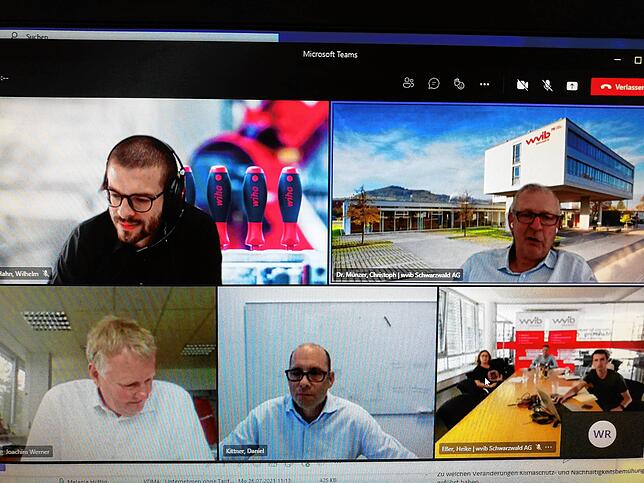
Bio-Äcker und Bürostühle: Sedus Stoll AG – Der Möbel-Bauer vom Hochrhein
Dass die Einrichtung von Büros und Häusern etwas mit Klima- und Umweltschutz zu tun hat, weiß man beim deutschen Marktführer für Büromöbel, der Sedus Stoll AG, schon lange. „Nachhaltigkeit ist bei uns schon immer Teil der Firmen-DNA“, sagt Daniel Kittner, Technikvorstand des Unternehmens aus Dogern am Hochrhein. Der Mittelständler, der 2020 mit rund 930 Mitarbeitern einen Umsatz von 184 Millionen Euro erwirtschaftete, gehört seit den 1980er Jahren mehrheitlich der Stoll-Vita-Stiftung. Und deren Stiftungszweck besteht auch in der „Förderung der gesunden Ernährung und des Umweltschutzes“.
Zu den Unternehmenszielen von Sedus gehörten daher „nachhaltiges Handeln“ und „soziale Verantwortung“, sagt Kittner. Als erstes Möbelunternehmen führten die Badener vor über einem Viertel Jahrhundert ein Umweltmanagementsystem ein und geben Nachhaltigkeitsberichte heraus. „Wir haben Transparenz über unsere Lieferanten, die Produkte und ihre Umweltauswirkungen“, sagt Kittner. Um diese möglichst gering zu halten, stellt man das Sortiment auf Recyclingmaterialien um. In so manchem Sitzbezug stecken heute keine Neukunststoffe mehr, sondern geschredderte PET-Flaschen. Für alle seine Produkte erstellt Sedus CO2-Bilanzen.

Beim CO2 soll es so weit wie möglich „runter auf Null“ gehen, sagt Kittner. Allerdings bleibt er Realist. Komplett klimaneutrale Produkte seien auf absehbare Zeit nicht erreichbar, sagt er. Allerdings nimmt der Betrieb, dessen Gründerfamilie anthroposophische Ansätze ins unternehmerische Handeln aufnahm, auch die Produktion ins Klima-Visier. Bis 2025 werde Sedus an seinen zwei deutschen Fertigungsstandorten klimaneutral sein, sagt Kittner. Dazu würden Stromversorgung und die Heizenergie auf öko umgestellt. Der Fuhrpark soll folgen. Und auch im Kleinen zeigt sich das Umwelt-Engagement.
In der Betriebskantine gibt es Essen, dessen Zutaten von Bio-Äckern der Firma aus der Umgebung stammen. Zur Klimapolitik sagt Kittner: Die EU „stolpere in die richtige Richtung“. Es sei an den Unternehmen, den Umbruch jetzt zu gestalten.
Blitzendes Alu: 3A Composites – Der Bau-Veredler am Tor zum Bodensee
Wenn Joachim Werner zweifelt, ob die ambitionierten Klimaziele der Bundesregierung für die Unternehmen machbar sind, erinnert er sich an alte Zeiten zurück und tankt Zuversicht. „Es ist noch nicht so lange her, da war der Rhein bei Düsseldorf eine stinkende, eklige Brühe“, sagt der Geschäftsführer des Singener Architektur- und Verkleidungs-Spezialisten 3A Composites. „Heute könnte man in dem Fluss baden.“

Die Kraft der Veränderung sei also da, und das gelte auch für scheinbar unabwendbare Klimafolgen. Dass die Politik ambitionierte Klimaziele setzt, findet Werner daher gut, was für einen Manager, dessen Unternehmen energie- und rohstoffintensiv produziert, keine Selbstverständlichkeit ist. Dass die Politiker die vermeintliche Lösung für die Klimakrise gleich mitliefern, hält er dagegen für kontraproduktiv. Keine vorgefertigten Lösungen, sondern Technologieoffenheit, lautet sein Motto. Die Wirtschaft sei der Träger der Innovation, sagt Werner. Die Firmen müssten daher selbst entscheiden, wie sie CO2 reduzierten.
Der Weg, den 3A Composites gewählt hat, heißt Leichtbau. Seit Jahren macht das Unternehmen, dessen Umsatz sich mit rund 1650 Mitarbeitern zuletzt auf etwa 600 Millionen Euro belief, Fassadenverkleidungen aus Alu und Kunststoff für Bauwerke immer leichter und beständiger. „Das Prinzip des Leichtbaus deckt sich eins zu eins mit CO2-Einsparungen“, sagt Werner. Denn geringes Gewicht bedeute weniger Material und Ressourcenverbrauch.

Am Standort Singen sei der CO2-Ausstoß je Produktionseinheit so in den letzten zehn Jahren um 50 Prozent gesunken, sagt er. Das Abwasser habe man um 60 Prozent reduziert. Ein kleines Kohlekraftwerk, das den Standort bisher mit Energie und Heizdampf versorgt, werde man durch eine Anlage ersetzen, die auf Gas und Wärmerückgewinnung setzt. Heute sei Kohle „aufgrund der CO2-Situation nicht mehr zukunftsweisend“. Um wettbewerbsfähig zu bleiben, müssten aber weltweit gleiche Standards gelten, sagt Manager Werner. Bis dahin sei ein Klimazoll für CO2-intensive Produkte, wie ihn die EU in ihrem Green Deal vorsieht, wichtig.
Schrauben für die Ewigkeit: Wiha – Der Werkzeug-Profi aus dem Schwarzwald
„Wir sehen die Herausforderung durch die neue Klimagesetzgebung sportlich“, sagt Wilhelm Hahn, Geschäftsführender Gesellschafter des Handwerkzeugherstellers Wiha Werkzeuge aus Schonach im Schwarzwald. „Wir wollen nicht Getriebene sein, sondern gestalten.“ Dazu investiert der Mittelständler, den manche als Hidden Champion bezeichnen, insbesondere in die Langlebigkeit seiner 10.000 Produkte, darunter etwa Schraubendreher, Zangen, Schneidmesser oder Bits für Elektrowerkzeuge.

Damit schlägt der Schonacher Familienbetrieb, der an 15 Standorten weltweit rund 1000 Mitarbeiter beschäftigt, zwei Fliegen mit einer Klappe. Denn Produkt-Haltbarkeit erhöht einerseits die Kundenzufriedenheit und senkt andererseits den Ressourcenverbrauch. Und der ist in der Branche hoch, denn Werkzeuge verkämen immer häufiger zu Wegwerfartikeln, sagt der Firmenchef. „Wir fragen uns, wie mancher Wettbewerber aus Fernost ein Produkt zu einem Preis verkaufen kann, zu dem wir nicht einmal die Rohstoffe einkaufen können“, sagt Hahn, der den Familienbetrieb in dritter Generation zusammen mit einem angestellten Manager leitet.
Um Stoffkreisläufe in Gang zu bringen erhöht Wiha – Umsatzziel 2021: 100 Millionen Euro – den Recyclinganteil seiner Werkzeuge und ersetzt Plastik-Verpackungen durch Pappe. Insbesondere in den USA, wo Kunststoff-Verpackungen als Standard gesehen werden, bedürfe es einiger Überzeugungsarbeit, diesen Ansatz zu erklären, sagt er. Nachhaltigkeitsaspekte rücken aber nicht nur beim Produkt, sondern auch in der Produktion weiter in den Vordergrund.

Für das eigene Werksgelände im Schwarzwald plant Wiha derzeit ein Nahwärmekraftwerk mit Holzpellets. Für nachhaltige Lösungen akzeptiere man „längere Amortisationszeiten“ und damit auch weniger Gewinn, sagt Firmen-Miteigner Hahn. Dass Ökologie Geld kostet, sieht der Wiha-Chef nicht als Problem. Allerdings müssten alle mitziehen. Die Praxis einiger Kunden, etwa aus der Automobilindustrie, Zusatzkosten auf die Zulieferer abzuwälzen, müsse abgestellt werden.








