Anja Fabel ist müde. Die vergangenen Jahre, sagt die Lehrerin, seien zehrend gewesen. Für die Schulen, ihre Kollegen, Eltern, die Kinder. „Ich bin ausgelaugt“, meint Fabel, die eigentlich anders heißt. Ihren echten Namen will sie nicht öffentlich machen – als Beamtin fürchtet sie um ihren Job, wenn sie ausspricht, was sie denkt. Wenn sie erzählt, was im deutschen Bildungssystem ihrer Ansicht nach so alles schiefläuft.
Viele Lehrer müssen am Wochenende arbeiten
Mit ihrem Frust steht die Pädagogin nicht alleine da. Corona aufarbeiten, Geflüchtete integrieren, individuell unterrichten: Die Lehrerinnen und Lehrer des Landes mussten zuletzt einiges leisten. Viele fühlen sich überlastet.

Eine Umfrage der Robert-Bosch-Stiftung – das Deutsche Schulbarometer – spricht sogar von einer alarmierend hohen Belastung von Lehrkräften im dritten Corona-Schuljahr. Demnach müssen drei Viertel aller Pädagogen auch am Wochenende ran, sich in der Freizeit zu erholen ist da kaum noch möglich. Die Hälfte ist körperlich oder mental erschöpft. Mehr als jede zehnte Lehrkraft plant, ihre Arbeitszeit, das wöchentliche Deputat, zu reduzieren.
Auch Anja Fabel, Mitte 30, hat mit diesem Gedanken gespielt. Sie unterrichtet in ihrem zwölften Jahr, ist Lehrerin für Deutsch, Geschichte und Religion an einer Schule im Schwarzwald. „Viele Menschen denken, wir tun nichts“, erzählt sie. „Aber die Zeit, die wir an der Schule verbringen, macht nur einen Teil unserer Arbeit aus.“ Die Unterrichtsvorbereitung, die Korrekturen, die Elterngespräche und Organisation – das sehen nur wenige. Der Aufwand als Klassenleitung? Riesig. Schon in vorpandemischen Zeiten sei der Druck auf Lehrer groß gewesen. Mit Corona aber spitzte sich die Lage zu.
Die Pandemie habe von Anfang an Chaos in die Schulen gebracht, betont die Pädagogin. Erst fehlte die geeignete Plattform für den Fernunterricht, dann die technische Infrastruktur, dann haperte es an Methoden, um den Kindern über einen Bildschirm überhaupt etwas beibringen zu können. Die Lehrkräfte mussten sich selbst behelfen, Unterstützung gab es kaum.
Lehrkräfte mussten die Arbeit anderer übernehmen
Als die Pandemie abklang, gingen die Schulen in ein Wechselspiel aus Homeschooling und Präsenzunterricht über. „Das mussten wir gleichzeitig stemmen.“ Zwischen Deutschstunden wanderte Anja Fabel also durch die Flure, um ein ruhiges Klassenzimmer zu finden, damit sie online Geschichte unterrichten konnte. Vor jedem Wochenende stellte sie eine Powerpoint-Präsentation zusammen – mit Kurzfilm, Arbeitsauftrag und Lösung. Jede Woche. Damit sie alle Kinder auf demselben Lernstand halten konnte.
Aufsätze korrigierte sie sonntags. „Andere Kollegen haben sich in dieser Zeit ausgeklinkt, weil es zu viel war.“ Wiederum andere mussten zuhause bleiben, weil sie schwanger oder gefährdet waren. Was liegen blieb, hatten die übrigen Pädagogen unter sich aufzuteilen.
Ein Moment der Krise, von dem auch das Kultusministerium weiß. „Tatsächlich kamen mit der Corona-Pandemie zahlreiche zusätzliche Aufgaben auf die Schulen zu“, heißt es hier auf Nachfrage. Allerdings hätten Überlastungen, die dadurch entstanden sind, mittlerweile zum Teil wieder abgenommen. Dem aber widersprechen Pädagogen.

Geblieben sind die Konsequenzen der Pandemie. Lernlücken zum Beispiel, die durch unzureichende Angebote des Landes kaum aufgeholt werden können. Soziale Defizite, die Kinder und ihre Lehrer noch über das Schuljahr hinaus beschäftigen dürften. So berichten Lehrkräfte laut Robert-Bosch-Stiftung von Konzentrations- und Motivationsproblemen, viele beobachten aggressives Verhalten bei ihren Schülern. Auch Anja Fabel kennt diese Probleme.
„Ich hatte das Gefühl, dass die Schüler nicht aus der Pandemie raus konnten.“ Es habe auffallend viele Fehlzeiten gegeben, viele Prüfungen, die nachgeschrieben werden mussten und Veränderungen in der Klassengemeinschaft: „Kinder treffen sich heute teilweise nicht mehr bei anderen zuhause, sondern virtuell über die Playstation.“
Vorschläge, was zu tun wäre, gibt es viele. Man müsse den Unterricht individueller gestalten. Klassen verkleinern. Den Ganztag stärken. Schulen in schwieriger Lage entlasten. Corona-Folgen aufarbeiten. Doch wenn es um die Umsetzung geht, dann landet man früher oder später beim gleichen Problem: Es bräuchte mehr Lehrerinnen und Lehrer. Die gibt es aber nicht.
Schon gar nicht angesichts des Ukraine-Kriegs, der immer mehr Eltern in den Westen flüchten lässt. Mit deren Kindern sei eine weitere sehr anspruchsvolle Aufgabe zugekommen, „die weder die Schulen noch wir uns ausgesucht haben“, heißt es dazu vom Kultusministerium.
580 Verträge bis Anfang Juli geschlossen
Dafür hat das Kultusministerium im vergangenen Jahr zusätzliche Mittel für Vertretungskräfte bereitgestellt. Dort haben sich bisher rund 2000 Personen gemeldet – darunter auch etwa 470 Lehrkräfte aus der Ukraine. Bis Anfang Juli wurden rund 580 Verträge geschlossen.
Das aber reicht nicht aus, monieren Gewerkschaften und Verbände. Zumal die Personalnot in der Branche keine neue sei, wie Matthias Schneider von der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft erklärt. In Baden-Württemberg seien aktuell 3700 Stellen offen. „Das sind unbesetzte Planstellen, die im System fehlen.“ Corona und der Krieg in der Ukraine – zwei Faktoren, die nicht vorherzusehen waren. „Aber die Demografie und Fachkräftemangel wohl“, betont der GEW-Geschäftsführer.

Der Lehrermangel ist also kein Symptom des Lockdowns oder später der Fluchtbewegung aus der Ukraine. Er ist eine Folge von kurzsichtiger Bildungspolitik. Die bittere Konsequenz: Im Schuljahr 2025/2026 werden hierzulande voraussichtlich 35.000 Lehrer fehlen – fünf Jahre später sind es schon 68.000, wie der Informationsdienst des Instituts der deutschen Wirtschaft, kurz IWD, berichtet.
„Wir sind unter Kante genäht“, sagt Gerhard Brand, Landesvorsitzender des Verbands Bildung und Erziehung, kurz VBE. Doch müsste der Job auch attraktiver werden. Hier gibt es nach Brand deutlich Ausbaupotenzial – etwa, was befristete Stellen betrifft. So würden allein in diesem Jahr 4000 Lehrkräfte in Baden-Württemberg den Sommer über nicht bezahlt – obwohl sie im neuen Schuljahr wieder gebraucht werden.
Eine davon ist Sonja Fehlmann, 41. Wie bei Anja Fabel waren auch ihre letzten Monate von Enttäuschungen durchzogen. Und auch sie möchte sich nicht unter ihrem richtigen Namen äußern, um nicht erkannt zu werden. Nur soviel: Fehlmann kommt eigentlich aus einem anderen Beruf, im März 2019 aber begann sie, Grundschülern im Schwarzwald das Schwimmen zu lehren. Die nötigen Referenzen brachte sie mit. Sie fing mit wenigen Stunden an. „Mir wurde zugesagt, im Jahr darauf die doppelte Stundenanzahl machen zu können“. Es kam anders, ihre Anstellung lief vor den Sommerferien aus.
Immerhin, sie wurde weiterempfohlen. Doch auch an den beiden anderen Schulen, an denen Fehlmann in den folgenden Jahren unterrichtete, hielt man sie hin, befristete sie, sagte ihr mehr Stunden zu, immer wieder. „Diese Arbeit habe ich mir nur leisten können, weil mein Mann gut verdient“, sagt sie. Obwohl die 41-Jährige zuletzt 20 Stunden arbeiten durfte, sei die ungewisse Zukunft belastend gewesen.
In diesem Jahr reichte es Sonja Fehlmann dann. Man habe ihr im Mai Bescheid geben wollen, ob sie im September wieder zum Unterricht antreten dürfe. Es kam aber nichts. Kein Telefonat, kein Schreiben. Vor zwei Wochen unterschrieb sie also bei ihrem alten Ausbildungsbetrieb. Am 27. Juli ist ihr letzter Tag an der Schule. Ein Abschied, den die Schwimmlehrerin bedauert. „Ich gehe mit einem weinenden Auge.“
Sonderpädagogen wandern in die Schweiz ab
Sonja Fehlmann ist ein Beispiel für die Fehler im Bildungssystem. Durch die 4000 befristeten Lehrstellen spart sich das Land Baden-Württemberg über die Sommerferien zwar 15 Millionen Euro. Doch zu welchem Preis, fragen sich Verbände und Gewerkschaften. Denn gerade dieser Umgang führe dazu, dass Sonderpädagogen im südbadischen Raum in die Schweiz abwandern. Dort liegen Löhne und Wertschätzung weit über deutschem Niveau. „Ein Skandal“, findet GEW-Geschäftsführer Matthias Schneider.
Es ist nicht so, als würde das Land nichts tun. So würden etwa Studienplatzkapazitäten vor allem an Grundschulen ausgebaut, erklärt Gerhard Brand vom VBE. Um dem Bedarf an Sonderpädagogen langfristig und nachhaltig zu begegnen, richtet das Land an der Pädagogischen Hochschule Freiburg zudem den Studiengang „Lehramt Sonderpädagogik“ mit 175 Studienanfängerplätzen ein. „Aber da ist man noch lange nicht fertig.“
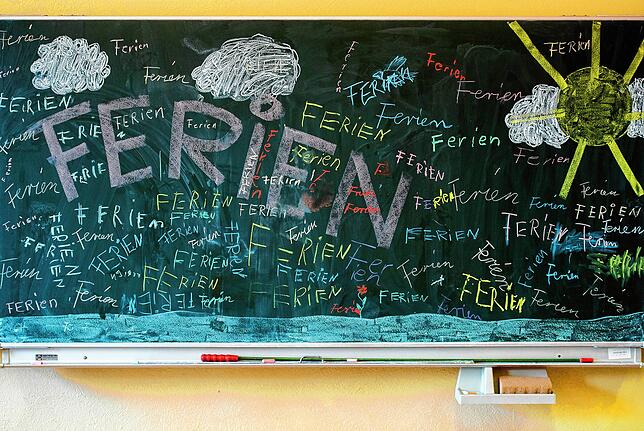
Man müsse die Studienkapazitäten stärker ausbauen. Und die Schwellen niedriger halten. „Von 100 jungen Leuten, die ein Lehramtsstudium starten, schließen bestenfalls 60 das Referendariat ab. Das ist zu wenig“, bekräftigt Gerhard Brand. Man könne heute nicht mehr nur die Besten aussieben.
Denn eines ist trotz der widrigen Arbeitsbedingungen erstaunlich: Lehrer mögen ihren Beruf in aller Regel. Zu diesem Schluss kommt ebenfalls das Deutsche Schulbarometer. Und auch Anja Fabel ist Lehrerin geworden, weil sie die Arbeit mit den Kindern liebt. „Mit ihnen zu reden, wie sie diskutieren, und Freunde daran haben. Zu sehen, wie sie Fortschritte machen.“ Dafür tue man es, auch wenn diese Begegnungen seltener geworden seien.






