Herr Pannwitz, was stand damals in Ihrer Grundschulempfehlung? Und lagen Ihre Lehrer damit richtig?
Hans-Georg Pannwitz: Ich komme aus Berlin, wo die Grundschule sechs Jahre dauert. An die Grundschulempfehlung kann ich mich gar nicht erinnern. Ich bin danach auf eine Gesamtschule gegangen und habe dann nach zehn Jahren meine mittlere Reife gemacht. Entscheidend waren die Lehrkräfte, die mich geprägt haben.
Wie war das bei Ihnen, Frau Broszat?
Karin Broszat: Nach der Grundschule habe ich das Gymnasium besucht. Die Empfehlung war zuhause nie ein Thema.
78 Prozent der Realschullehrer im Land fordern die Rückkehr der verbindlichen Grundschulempfehlung. Warum?
Broszat: Eltern treffen die Schulwahl nach anderen Kriterien als Grundschullehrer. Da geht es nicht immer in erster Linie um die Leistungsmöglichkeit des Kindes, sondern zum Beispiel darum, wo die Freunde hingehen oder womöglich, wie das Schulgebäude aussieht. Viele meiden die Hauptschule, weil sie vorschnell den höchstmöglichen Bildungsabschluss für ihre Kinder wollen.
An der Realschule werden deshalb auch Kinder angemeldet, die eigentlich eine ganz andere Methodik und Didaktik bräuchten. Gleichzeitig verschwinden die für viele Kinder so wichtigen Haupt- und Förderschulen. Schon ab Klasse 6 wechseln frustrierte Kinder vom Gymnasium an die Realschule, weil sie am Gymnasium überfordert sind. Lehrkräfte wissen, dass sie nicht allen gerecht werden können.
Herr Pannwitz, können Sie diesen Frust verstehen?
Pannwitz: Natürlich kann ich den verstehen, weil die Realschulen nicht darauf eingestellt sind. Die Frage ist: Wie reagiere ich auf Heterogenität in der Gesellschaft? Ich bin der Überzeugung: Da müssen sich Schulen verändern.

Broszat: Für ein differenziertes und vielfältiges Schulsystem ist eine Aufteilung der Schüler unabdinglich, um sie optimal zu fördern. Aufgeteilt werden kann nur nach Leistungsfähigkeit, weil das am gerechtesten ist. Unterschiedliche Kinder brauchen unterschiedliche Schularten. Wird die Realschule zur Schule für alle, geht die Mitte, auch in unserer Gesellschaft, verloren. Der Arbeitsmarkt klagt über einen nie dagewesenen Fachkräftemangel. Die Realschule hat diese Mitte immer erfolgreich abgebildet. Das schafft sie nicht mehr, wenn alle Kinder gleich beschult werden sollen.

Herr Pannwitz, Sie sind ein Befürworter der unverbindlichen Empfehlung. Eine Folge davon ist allerdings, dass 16 Prozent der Kinder mit Realschul-Empfehlung das Gymnasium besuchen, und ein Drittel der Kinder mit Werkreal-Empfehlung an der Realschule sind. Sind diese Kinder nicht an der falschen Schule?
Pannwitz: Ich glaube nicht, dass sie per se an der falschen Schule sind. Weil das immer Momentaufnahmen sind. Die Grundschulempfehlung bildet ja nur ab, wie der Leistungsstand nach Klasse vier ist. Ich glaube, man kann nach Klasse vier noch nicht einschätzen, wie sich das Kind entwickeln wird. Diesen Druck zu nehmen von den Grundschullehrkräften, von den Kindern und den Eltern, war ein wichtiges Ziel, als man die verbindliche Grundschulempfehlung abgeschafft hat. Das ist aber nicht so erfolgreich, wenn ich das System nicht weiterdenke. Allein durch das Abschaffen schaffe ich nicht mehr Bildungsgerechtigkeit.
Wie schlimm war der Druck auf Grundschullehrerinnen und -lehrer?
Pannwitz: Teilweise hatten sie Rechtsverfahren am Hals. Das ist natürlich Irrsinn. Teilweise sagen sie aber auch, dass manche Eltern heute beratungsresistent sind.
Es ist heute oft die Rede vom „Grundschul-Abitur“. Es sieht nicht so aus, als ob der Druck auf die Kinder geringer geworden wäre.
Pannwitz: Ich glaube, dass wir diesen Druck rausnehmen müssen, indem wir die Kinder länger zusammen lernen lassen. Es gibt keine pädagogische Begründung dafür, dass wir die Kinder schon nach Klasse vier trennen. Das ist eine rein politische Entscheidung. Alle Länder, die bei Bildungsstudien international weit vorne landen, teilen nicht so früh.
Da gibt es aber auch andere Studien. Bei den IQB-Bildungstrends liegt zum Beispiel Bayern ganz weit vorn.
Broszat: So ist es! Vor Abschaffung der verbindlichen Grundschulempfehlung war Baden-Württemberg auf Spitzenplätzen. Seitdem geht es stetig bergab. Die Rückkehr zur Verbindlichkeit ist schon immer eine Kernforderung des Realschullehrerverbands. Damals wurde uns ‚Aussortieren‘ vorgeworfen. Jetzt zeigt eine Studie nach der anderen, dass hier Weichen in der Bildungspolitik falsch gestellt wurden. Wenn man übrigens meint, Druck wäre durch die abgeschaffte Grundschulempfehlung weg, verkennt man, dass dieser umso stärker auf einem Kind lastet, wenn Erfolgserlebnisse in der weiterführenden Schule bei den dann Jugendlichen ausbleiben. Das klammern Sie aus, Herr Pannwitz.
Pannwitz: Tatsächlich hat der Wegfall der verbindlichen Grundschulempfehlung die Heterogenität an den Realschulen noch verstärkt. Die Frage ist: Wie reagiere ich drauf? Der Frust bei den Realschulkollegen ist da, weil sie keine adäquate Antwort finden. Die Gemeinschaftsschulen versuchen, auf drei oder vier Niveaus, auch für die Förderkinder, den Unterricht zu stemmen. Ich muss mich als Lehrkraft auf die veränderte Gesellschaft einstellen. Wir reden seit 20 Jahren davon, dass die Hauptschule gestärkt werden soll. Aber es gibt sie de facto fast nicht mehr. Sie wird‘s auch nicht mehr geben.
Warum schafft das die Gemeinschaftsschule, was für die Realschule schwierig ist – sich auf ganz unterschiedliche Kinder einzustellen?
Pannwitz: Wir sehen uns in der Gemeinschaftsschule als Team. Sie schauen gemeinsam mit den Kollegen aller Schularten: Wie kriegen wir das hin? Wir differenzieren auf verschiedenen Niveaus, das ist ein Haufen Arbeit. Wir sind im Ganztag da. Und wir sind trotzdem am Anschlag, weil unser Job nicht mehr nur ist, den Kindern Wissen zu vermitteln. Unsere Gesellschaft hat sich verändert, 40 Prozent der Kinder an der Grundschule haben Migrationshintergrund. Das Ziel muss sein, diese bestmöglich zu fördern.
Haben Sie mehr Manpower?
Pannwitz: Wir haben nicht mehr Stunden, aber wir geben Stunden für mehr Differenzierung aus. Aber wir arbeiten trotzdem vorne und hinten mit Mangel, weil wir gar nicht mehr genug Fachkräfte haben. Wir müssen immer wieder improvisieren.
Das müssen doch aber alle, auch die Gymnasien.
Pannwitz: Da muss ich aber sagen: Die bewegen sich nicht so stark, auch manche Realschulen nicht, weil sie manche Entwicklung nicht mitmachen mussten. Es gibt natürlich auch starke Realschulen und schwache Gemeinschaftsschulen. Die Schullandschaft verändert sich, die Dreigliedrigkeit passt nicht mehr zu dieser Heterogenität. Damit muss ich mich arrangieren und Antworten finden. Da ist die Gesellschaft zu langsam, sich zu ändern.
Ich würde gerne auf die Kinder schauen. Wie sind Ihre Erfahrungen: Bleiben die Kinder reihenweise sitzen, oder senken die Lehrer die Anforderungen?
Broszat: Das ist ganz unterschiedlich. Am meisten sorgen wir uns um die schwachen Kinder. Ein Schüler, der sich ständig nur an besseren messen muss, wird leicht verhaltensauffällig. Das ist nicht dem Kind anzulasten, sondern dem System! Alle Kinder an einer Schulart zu unterrichten, halten wir nicht nur für völlig falsch, sondern auch für unökonomisch. Es brauchen nicht alle Schulen gleich viele Förderkurse und zusätzliches Personal. Unterschiedliche Kinder brauchen unterschiedliche Schulen, die ihren Begabungen und Leistungsmöglichkeiten gerecht werden.
Herr Pannwitz, was löst das bei Kindern aus, wenn sie es nicht packen?
Pannwitz: Frust, ist doch logisch. Aber ich will auch sagen, dass Kinder sehr wohl wissen: Wenn ich heute an der Hauptschule bin, bin ich der Restschüler. Auch das bedeutet Frust. Wir müssen weg von dieser dämlichen Kategorisierung nach Leistungsstufen. Ich muss doch überlegen: Wie werde ich dem Kind gerecht in dieser veränderten Welt?
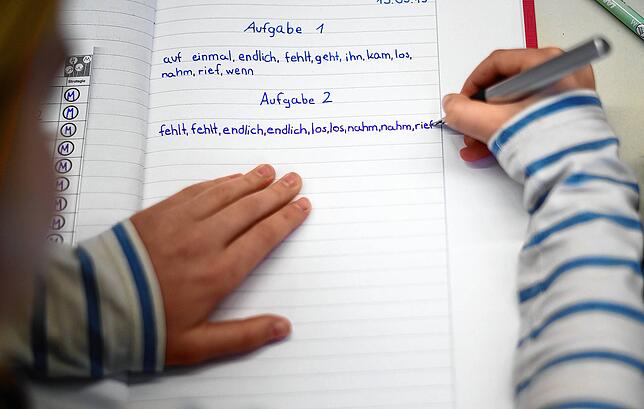
In den Vera-Vergleichsarbeiten und bei den IQB-Bildungstrends sind Baden-Württembergs Schüler zurückgefallen. Weil zu viele Schüler die falsche Schule besuchen?
Pannwitz: Das hat sicherlich auch damit zu tun. Aber es wäre zu einfach gedacht, das Problem damit lösen zu wollen, wieder die verbindliche Grundschulempfehlung einzuführen. Schauen Sie sich an, welches Bundesland bei den Bildungsvergleichen weit vorne liegt: Hamburg. Was zeichnet das Schulsystem dort aus? Die haben eine Schule für alle bis Klasse zehn, neben den Gymnasien.
Außerdem arbeiten sie mit multiprofessionellen Teams an den Schulen, vergeben gezielt Ressourcen für die Bezirke, die es besonders nötig haben, und es gibt eine verbindliche Sprachförderung. Baden-Württemberg steuert da jetzt nach, gibt künftig auch sozialindexbasierte Mittel an die Schulen. Das ist richtig, weil es beispielsweise an Schulen, in denen mehr ausländische Kinder sind, auch mehr Geld für Sprachförderung braucht.
Broszat: Ich finde es schon bemerkenswert, wie das Kultusministerium sich an diesem Stadtstaat, in dem es Vielgliedrigkeit gar nicht gibt, orientieren will. Bayern, Spitzenreiter in allen Ländervergleichen, dagegen ist ein Flächenland mit entsprechend viel Migranten wie Baden-Württemberg.
Ich plädiere ausdrücklich dafür, dass man sich realistisch und pragmatisch an erfolgreichen Ländern orientiert, die von der Struktur vergleichbar sind. Wir legen im Moment millionenschwere Programme auf, Bildungspolitiker reisen nach Kanada und sonst wohin, anstatt pragmatisch ein Modell wieder einzuführen, das sich schon bewährt hat.
Was könnte man von Bayern lernen?
Broszat: Bayerns Schulsystem hat dank verbindlicher Grundschulempfehlung eine stabile Mitte. Die berufliche Bildung hat neben der akademischen Bildung einen hohen Stellenwert. Das ist eine Investition in die Zukunft gegen den eklatanten Fachkräftemangel! Von Bayern kann man einen pragmatischen Ansatz lernen, wie man im bestehenden Schulsystem, kostengünstig eine bestmögliche Förderung hinbekommt. Die multiprofessionellen Teams von denen Sie sprechen, Herr Pannwitz, sind ja toll, aber auch dafür braucht das Land Fachkräfte, die es nicht hat. Man muss doch realistisch an die Sache rangehen!
Pannwitz: Im Gegenteil: Wer jetzt die Grundschulempfehlung zurück will, verschließt die Augen vor der Realität. Wenn wir so viel Veränderung in der Gesellschaft haben, einen so hohen Migrationsanteil, muss ich doch als Pädagoge darauf reagieren. Mit der verbindlichen Grundschulempfehlung schaffe ich mir, böse gesagt, die Kinder vom Hals, die ein bisschen anders ticken. Lernen Sie doch, mit dieser Vielfalt umzugehen.
Broszat: Und genau das tut man, indem man unterschiedlichen Kindern eine Vielfalt von Schulen mit entsprechender Durchlässigkeit bietet, die sie entlang ihrer Leistungsmöglichkeiten und Begabungen optimal fördern. Das würde Kindern, Eltern und Lehrkräften das Schulleben deutlich erleichtern!







