Wissenschaftler befragten in den Jahren 1894 und 1895 in 1500 Orten Badens Menschen nach ihrem Alltagsleben. Auch in Bad Säckingen wurden damals Daten erhoben. In diesem Beitrag berichteten wir, welche Ansichten und Bräuche anlässlich bestimmter Lebensstationen wie Geburt, Taufe, Eheschließung, Tod vor 130 Jahren üblich waren.
Geburt und Taufe: Getauft wird am Sonntag nach der Geburt
In Säckingen brachte laut der Volksüberlieferung nicht der Storch die Babys, sondern die Hebamme holte sie aus dem Bergsee. Bei unehelichen Kindern bestimmte der Pfarrer den Namen des Neugeborenen. Die Taufe fand gewöhnlich am Sonntag nach der Geburt statt. Taufnamen waren beispielsweise Fridolin, Hilarius, Johann, Joseph, Jakob, Martin, Georg, Anton, Franz, Ignaz, Maria, Anna, Fridolina, Luise, Emma, Lydia, Bethas und Margarethe. Das Patenamt übernahmen meist Bekannte oder nahe Verwandte. Der Götti schenkte dem Patenkind Geld und die Gotti Kleider. Ferner beschenkte der Pate den Messner und die Patin die Hebamme. Starb ein Baby, so war der Pate für den Sarg und das Kreuz zuständig.
Uneheliche Mütter: Für sie ist in der Kirche der „Hurenstuhl“ bestimmt
Gebar eine ledige Frau ein Kind, so hatte sie noch bis nach dem Zweiten Weltkrieg viel Leid zu ertragen. Für solche Frauen war in der Kirche in Wallbach ein besonderer Stuhl bestimmt, der „Hurenstuhl“. Keine ledige oder verheiratete Frau stand im Gottesdienst neben ihr.
Zu bedauern waren auch die unehelich geborenen Kinder. Sie waren vom Spielen mit anderen Jungen und Mädchen ausgeschlossen. Im Geburtsort hatten die Mütter lediglich das Heimatrecht. Verwehrt war ihnen auch das Erbe des mütterlichen Vermögens.
Kindheit: Der Geburtstag von Kaiser und Großherzog wird groß gefeiert
An Ostern begann das Schuljahr. Die schulpflichtigen Kinder besuchten die Schule ganztägig. Besondere Schulfeste waren der Kaiser- und Großherzogtag. Auf dem Programm standen Festgottesdienst, Ansprachen durch die Lehrer und das Singen von Liedern.
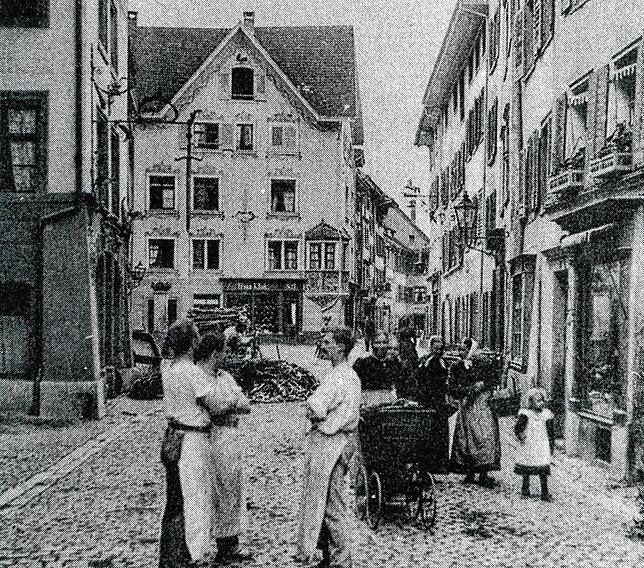
Schon in den Kinderjahren mussten die Mädchen und Jungen dazu beitragen, das tägliche Brot zu verdienen. Die Mithilfe in Haus, Feld und Stall sowie das Beerensammeln waren Selbstverständlichkeiten.
Brautwerbung: Fingernägel im Wein als Liebeselexier
Bekanntschaften zum anderen Geschlecht wurden in der Regel zwischen 14 und 18 Jahren geknüpft. Zu Mädchen zu gehen, war für Burschen nicht üblich. Günstige Gelegenheiten boten sich im Winter beim Schlittenfahren, nach dem Nachtessen oder nach dem Abendessen, wenn sich Mädchen auf dem Weg zu ihren Zusammenkünften befanden. Um sich ein Mädchen gewogen zu machen, schabte der Bursche Fingernägel in roten Wein und gab diesen der Angebeteten zu trinken. Dies mache heiß in der Liebe, glaubte man.
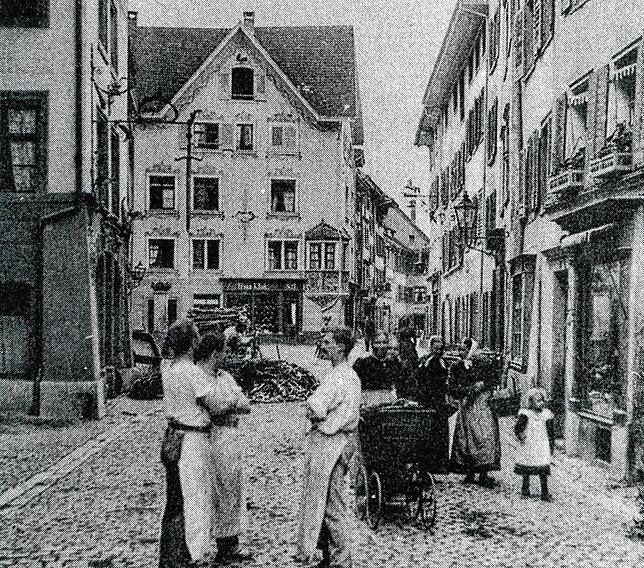
Eine Bewährungszeit für die beiden Liebenden bildete die Militärzeit. Bestanden danach noch ernste Absichten, hielt der junge Mann im Hause der Eltern der zukünftigen Braut um deren Hand an. Noch bis 1860 war das Heiraten an das Vermögen gebunden. So konnte die Gemeinde eine Heirat verbieten, wenn ein Mindestvermögen nicht vorhanden war.
Hochzeit und Ehe: Der Bräutigam tritt der Braut auf die Füße
Wenn die Eheabsicht in der Kirche verkündet war, so hießen die Brautleute „Hochzitter“ und „Hochzitterin“. Von da an trug die Braut schwarze Kleider. Hochzeitstage waren meist Montag oder Donnerstag. Die Hochzeitsfeier begann im Haus mit einem Glas Wein. Die Braut trug meist ein schwarzes oder weißes Kleid. Wenn sich Braut und Bräutigam bei der Trauungszeremonie die Hände reichten, musste der Bräutigam den Daumen nach oben halten. Ebenso versuchte er, mit seinen Zehenspitzen auf die Zehen der Braut zu treten, damit er der Herr im Hause wird. Die weltliche Feier fand oft in einem Gasthaus statt.
Unglück für die Braut brachte Regen am Hochzeitstag. Dies bedeutete, die Zukunft der Braut wird tränenreich. In Säckingen behielt man gerne die ledigen Geschwister als Knechte und Mägde an seinem Tisch und hinderte sie, wenn möglich, am Heiraten, um sie wie man sich ausdrückt, „ins Hus z‘metzge“.
Krankheiten: Gelbsucht wurde mit gelb blühnden Kräutern behandelt
Um Krankheit und Tod rankten sich die verschiedensten Erklärungsversuche. Auch äußere Krankheiten erschienen dem Volk nicht als natürliche Vorgänge, sondern als unerklärlicher Zauber, der insbesondere bei dämonischen Mädchen und Tieren auf dem Körper oder im Körper zur Wirkung kam. Bei der Behandlung von Krankheiten galt der Grundsatz: Ähnliches wird mit Ähnlichem behandelt. So wurde etwa versucht, die Gelbsucht mit gelb blühenden Kräutern zu heilen.
Tod und Trauer: Das Seelenmännle gibt Auskunft, auf welcher Himmelsstufe der Verstorbene sich befindet
Vorboten des nahen Todes waren das Graben des Maulwurfs, wenn ein Kreuzschnabel in der Nähe des Kranken Laut gibt, krächzende Raben oder Elstern. Nach dem Tod eines Menschen kamen in Säckingen die Angehörigen und Nachbarn am Abend im Schlafzimmer des Verstorbenen zusammen, um Rosenkränze zu beten. Um sich davon zu überzeugen, auf welcher Himmelsstufe sich die Seele des Toten befindet, fragte man in Harpolingen das „Seelenmännle“. Dieses ließ sich die Auskunft gut bezahlen. Dafür versprach es, die Seele auf eine höhere Stufe hinaufzuschaffen. Es hatte großen Zulauf. Die Trauerzeit für Eltern betrug ein Jahr, für Geschwister und Großeltern ein halbes und für Kinder, Onkel und Tanten ein viertel Jahr.






