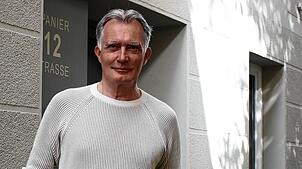Wie soll das Krankenhausgebäude genutzt werden, wenn das Klinikum Hochrhein dereinst seinen Betrieb in den geplanten Neubau verlegt haben wird? Diese Frage beschäftigt Stadtverwaltung, Gemeinderat und Bürger von Waldshut-Tiengen bereits seit geraumer Zeit und ist immer wieder Gegenstand energischer Diskussionen. Am Anfang aller Planung steht nun eine gutachterliche Einschätzung, was rechtlich überhaupt möglich ist. Diese erhielt der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung.
Stiftungsrecht setzt enge Grenzen
Einkaufszentrum, Freizeit-Angebot oder alternative Wohnformen? Oder am Ende doch eine Nutzung als Büro-Komplex oder innovative Co-Working-Spaces? Bisweilen kursierten gerade in Wahlkampfzeiten schon ebenso spannende Ideen, was aus dem Krankenhaus werden könnte.
Für all jene, die bisher solchen Vorstellungen nachhingen, war die Einschätzung des Hannoveraner Juristen Daniel Schubmann wohl eher eine kalte Dusche. Dessen Kanzlei hatte die Stadt bereits während des Ausstiegs des Spitalfonds aus der Klinik-Trägerschaft beraten. Gerade mit den Vorgaben der Stiftungssatzung, die aus dem Jahr 1411 datiert, kennt Schubmann sich daher sehr genau aus. Diese Satzung setze der weiteren Planung für eine Nachnutzung aus rechtlicher Sicht enge Grenzen, so Schubmann. Insbesondere müssten alle folgenden Nutzungen einen karitativen Schwerpunkt haben.
Drei Optionen wären möglich
„Es gibt drei Optionen: Den Verkauf des Geländes an einen Dritten, eine temporäre Nutzungsübertragung oder eine eigene Nutzung durch den Spitalfonds“, schildert Schubmann.
Dabei sei zu berücksichtigen, dass der Verkauf im Grunde nur dann zulässig sei, wenn der Stiftungszweck nicht mehr erfüllt werden könne. „Das ist aber nicht zu erwarten.“ Zwar falle der ein Teil des Stiftungszwecke weg, denn der Betrieb und Unterhalt eines Krankenhauses in der Großen Kreisstadt sei ausgeschlossen, wenn das Klinikum aus dem Haus ausziehe.
Verkauf des Geländes praktisch unmöglich
„Der Stiftungszweck wurde allerdings vor einigen Jahren erst erweitert“, so Schubmann weiter. Hinzu gekommen sei die Formulierung „andere soziale Einrichtungen“. Und dieser sei aus stiftungsrechtlicher Sicht extrem dehnbar, umfasse Altenpflege ebenso wie Kinderbetreuung.
„Aus diesem Grund hat die Stiftungsaufsicht bereits 2018 einen Verkauf ausgeschlossen“, erinnerte Schubmann. An diesen Rahmenbedingungen habe sich nichts geändert.
Für Verpachtung oder Eigennutzung gelten strenge Vorgaben
Alternativ bliebe die Nutzungsübertragung an einen Pächter – wie das bereits jetzt im Fall der Klinikum Hochrhein gehandhabt wird – oder die eigenständige Nutzung durch den Spitalfonds. Beide Optionen beinhalteten allerdings genauso, dass die weitere Nutzung mit dem Stiftungszweck des Spitalfonds übereinstimme – also wohltätige Tätigkeiten unterstützt würden.
Die Verpachtung an ein produzierendes Unternehmen sei damit nicht vorstellbar, auch eine Nutzung der Räumlichkeiten als Büros für die Stadtverwaltung oder ähnliches scheide aus.
Kann man den Stiftungszweck ändern?
Die Frage nach einer Abänderung oder Aktualisierung der 612 Jahre alten Stiftungssatzung dränge sich zwangsläufig auf, wie Schubmann einräumte. Das sei aber nicht einfach: „Identitätsverändernde Zweckänderungen sind nur möglich, wenn das Stiftungsvermögen aufgebraucht ist oder der Zweck nicht mehr erfüllt werden kann.“ Da karitative Tätigkeiten immer in irgendeiner Form möglich seien, sei im Grunde auszuschließen, dass dieser Fall eintrete.
„Über alle Änderungspläne hat am Ende die Stiftungsaufsicht zu entscheiden“, betonte Schubmann. Und es sei nicht zu erwarten, dass diese so einfach eine Änderung genehmigen werde, zumal die Satzung des Spitalfonds eigentlich gar keine Änderung vorsehe.
Die beschlossenen Erweiterungen des Stiftungszwecks, die im Zuge der Erbauung des Mathias-Claudius-Heims vorgenommen wurden, das vom Spitalfonds gebaut und an das Diakonische Werk verpachtet wurde, könnten unterdessen auch nicht einfach revidiert werden, da die Stiftungsaufsicht auch dies genehmigen müsse.
Wie geht es nun weiter?
Noch ist nicht die Zeit gekommen, alle Pläne fahren zu lassen. Wie die Erste Beigeordnete Petra Dorfmeister darstellte, regle das Baurecht Begrifflichkeiten sie „soziale Einrichtungen“ wesentlich konkreter als das Stiftungsrecht. Potenzial biete auch der Hinweis, dass das Gebäude „überwiegend“ für karitative Zwecke genutzt werden müsste.
Dies sei vor allem mit Blick auf die Größe des Gebäudes zu bedenken, so Dorfmeister. Denn auch wenn die soziale Ausrichtung durchaus Chancen biete – etwa im Bereich soziales Wohnen oder auch Pflege: Bei einem derartigen Objekt Leerstände zu vermeiden sei eine gewaltige Herausforderung.
Wie Anwalt Schubmann darstellte, seien Mischformen in gewissem Umfang durchaus vorstellbar: „Ein Café ist ja beispielsweise schon jetzt vorhanden.“ Weitere sogenannte mitgezogene Service- und Dienstleistungsangebote ließen sich auch in Zukunft in dem Gebäude vorstellen, insbesondere auch Einzelhandel in beschränktem Umfang.
Ohnehin war das nun präsentierte rechtliche Gutachten erst der Startschuss für den Planungsprozess zur Nachnutzung des Klinikums. Zeitdruck besteht dabei nicht, da der geplante Neubau des Krankenhauses in Albbruck ohnehin erst gegen Ende des Jahrzehnts bezugsfertig sein soll.
Auf dem Weg zum Zentralklinikum im Kreis Waldshut
- 19. April 2023: Kreistag macht den Weg frei
- 18. April 2023: 350 Betten und der Zeitplan: Neue Details zum Zentralkrankenhaus in Albbruck
- 31. Dezember 2022: Lange nichts gehört. Was läuft eigentlich in Sachen Zentralkrankenhaus Albbruck?
- 30. März 2022: Ein Bauschild an der Bundesstraße bei Albbruck soll Zeichen des Fortschritts in Sachen Zentralkrankenhaus sein. Doch bis gebaut wird, gibt es noch viel zu tun.
- März 2022: Günther Bickel ist neuer Projektleiter für den Gesundheitspark Hochrhein. Er soll den Bau des Zentralklinikums in Albbruck voranbringen und bis zur Fertigstellung begleiten.
- 1. Oktober 2021: Mit einem symbolischen Scheck über sechs Millionen Euro kam Landesgesundheitsminister Manfred Lucha nach Albbruck. Es ist der erste Zuschussbescheid für das geplante Zentralkrankenhaus, das im Jahr 2028 in Betrieb gehen soll.
- August 2021: Sozialminister Manfred Lucha räumt Zweifel aus: ‚Natürlich kommt das Zentralklinikum in Albbruck‘.
- August 2021: Der Verlust beim Klinikum Hochrhein fällt wegen der Corona-Pandemie deutlich höher aus.
- Juli 2021: Der Waldshuter Kreistag verabschiedet die Masterplanung für das geplante Zentralkrankenhaus, das im Jahr 2028 in Albbruck seinen Betrieb aufnehmen soll.
- Mai 2021: Der Landkreis sucht Unternehmen für den Bau des Klinikums.
- März 2021: Landrat Kistler spricht im Albbrucker Gemeinderat über den aktuellen Stand.
- März 2021: Das Medizinkonzept steht: Welche Behandlungen werden im Zentralklinikum möglich sein? Hier die Antwort.
- Frühjahr 2021: Bis die Gesundheitsversorgung in Albbruck funktioniert, muss das Klinikum Hochrhein in Waldshut leistungsfähiger werden: Es wird angebaut.
- Dezember 2020: Wie passt der Standort des Zentralspitals mit der Hochrheinautobahn A98 zusammen? Hier die Hintergründe.
- Dezember 2020: Einblick in den Masterplan des geplanten Zentralklinikums ‚Gesundheitspark Hochrhein‘.
- September 2020: Ein Ziel, aber unterschiedliche Wege zum Zentralspital. Ein Vergleich der Projekte in den Landkreisen Lörrach und Waldshut.
- März 2020: Wirbel um einen nicht-öffentlich gefassten Beschluss im Kreistag zum Medizinkonzept.
- März 2019: Nun steht es fest: Der Standort für das geplante Zentralspital im Kreis Waldshut soll in Albbruck gebaut werden.