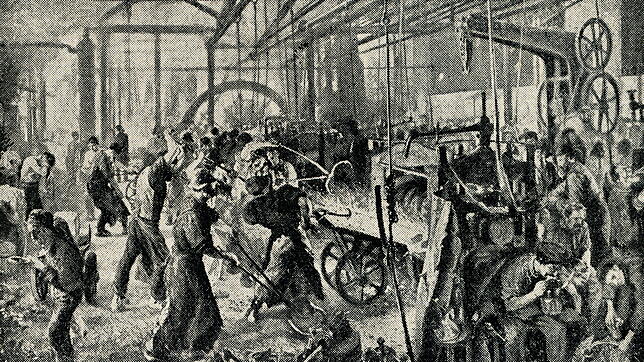Es ist Montag, der 12. September 2016, und Ulrike ahnt zu Beginn ihres Arbeitstages nichts von der kalendarischen Willkür des Schicksals. Ein Auftrag lautet, mal eben den Container von der Rampe zu rollen und warum soll sie das nicht tun? Zwar hat Ulrike das noch nie gemacht, aber sie ist zu diesem Zeitpunkt bereits seit 24 Jahren bei der Maggi in Singen beschäftigt und in der Produktion hilft man sich bei Engpässen aus.
Dann passiert es, der Container kippt. Zwischen 150 bis 200 Kilogramm stürzen auf die Frau, sie fällt rücklings zu Boden. Die Beine eingeklemmt, der vierte Lendenwirbel geborsten, ein inneres Organ nimmt irreparablen Schaden – so liegt sie bewegungslos unter dem Container. Ulrikes Blick irrt umher, ungläubig bleibt er bei einer Uhr haften. Sie zeigt 11.55 Uhr.
Knapp zweieinhalb Jahre später schildert die heute 49-Jährige im Anschluss an die Verhandlung vor dem Arbeitsgericht Radolfzell den Unfall an jenem Tag, zu jener Stunde und wie der Blick auf die Uhr sich für immer ins Gedächtnis ätzt. Es folgen Operationen, Rehabilitationsaufenthalte, die Wiedereingliederung ins Arbeitsleben. Seit Februar 2018 arbeitet sie wieder bei der Maggi, jetzt allerdings übernimmt sie Bürotätigkeiten im produktionsnahen Bereich.
Nichts ist mehr wie es früher war
Gut ist deswegen nichts. Der Schmerz ist Ulrikes ständiger Lebenspartner, sie benötigt ein spezielles Bett, das Auto musste sie umbauen lassen, damit sie von ihrem Wohnort im Hegau überhaupt an ihren Arbeitsplatz in Singen kommt. Sie kann inzwischen ohne Krücken laufen, aber für das teils gelähmte linke Bein braucht sie eine Schiene und bücken geht gar nicht, weshalb sie auf Dienstleistungen der Sozialstation angewiesen ist. Auch wegen ihrer seelischen Verfassung will sie das Wort Lebensqualität nicht in den Mund nehmen. "Eine Frau mit 80 ist fitter als ich", sagt sie.
Der Unfall und die Folgen sind in der Verhandlung vor dem Arbeitsgericht Radolfzell unter Leitung von Richter Carsten Teschner unstrittig. Erschienen sind neben der Klägerin und ihrem Anwalt Thomas Daum die Vertreter des Arbeitgebers – die Personalchefin von Maggi, ein Sachverständiger aus dem Betrieb sowie der Rechtsbeistand. Es geht darum, ob Ulrike ein Ersatz für den Verdienstausfall in Höhe von rund 17.500 Euro sowie ein Schmerzensgeld von 75.000 Euro zusteht.
Zahlreiche Vorfälle
Das Schicksal lässt sich übrigens nicht vor Gericht blicken, es hat wohl anderweitig zu tun. Thomas Daum kann das verstehen, denn ans Schicksal mag er in diesem Fall ohnehin nicht glauben. Bevor es zu dem Arbeitsunfall der 49-Jährigen kam, gab es diverse ähnliche Vorfälle – zwei Mal sogar mit Verletzungen. Auch das ist unstrittig, seit spätestens 2014 wusste man im Betrieb von den Problemen bei der Handhabung der Roll-Container beziehungsweise der Gefahren durch die Rampe. Dass so ein Container dabei wegen des verhältnismäßig hohen Schwerpunkts kippen kann, war beispielsweise aufgrund eines Vorfalls im Jahr 2015 bekannt.
Dieses Wissen ist der größte Feind des Schicksals und also fragt Carsten Teschner nach, warum sich der Arbeitgeber nicht um die Behebung des Missstands gekümmert habe. Hat man ja, lautet die Antwort. Aber so einfach sei das gar nicht. Schnell geht es vor Gericht alsdann ums Detail. Nicht die Rampe sei das eigentliche Problem und auch nicht die Container, sondern die Räder und auch die nur dann, wenn man damit gegen einen Widerstand gerate. Es sei probiert und getüftelt worden, nachgedacht wurde über eine längere Rampe, es gab Reparationen der Räder, jeden einzelnen Wagen habe man sich angeschaut – bis endlich die Erkenntnis reifte, dass der Höhenunterschied das Kernproblem darstellt. Dieses lasse sich statt Rampe und Roll-Containern am besten mittels einer Hubvorrichtung beseitigen.
Arbeitsschutz ist eine Bringschuld
Für Thomas Daum sind das Ausflüchte. Der Rechtsanwalt der Klägerin führt ins Feld, dass die Probleme seit langem bekannt gewesen seien, zig Mal sei der Sicherheitsbeauftragte informiert worden, einmal habe ein Mitarbeiter gerade noch beiseite springen können und von all den nicht gemeldeten Fällen wolle er und seine Mandantin gar nicht reden. Obwohl das Risiko also bekannt gewesen sei, habe man nichts oder jedenfalls zu wenig für die Sicherheit der Mitarbeiter unternommen. Erschwerend hinzu komme die unterbliebene Information über die Gefahren beziehungsweise eine Einweisung in die Tätigkeit mit ihren speziellen Erfordernissen. "Sie haben meine Mandantin ins offene Messer laufen lassen", so der Vorwurf des Anwalts. Im Nachgang der Verhandlung verweist der Jurist außerdem auf die Bringschuld des Arbeitgebers beim Arbeitsschutz.
Am Ende freilich gewinnt das Schicksal doch. In der Begründung seines Urteils kann Richter Carsten Teschner keinen "bedingten Vorsatz" des Arbeitgebers erkennen – der aber ist Voraussetzung für die Anerkennung eines Verdienstausfalles und erst recht für das geforderte Schmerzensgeld. Ein solcher Vorsatz sei nur dann anzunehmen, wenn er gewollt war oder billigend in Kauf genommen wurde. Allein die Dokumentation von vorangegangenen Arbeitsunfällen und die in diesem Zusammenhang angestellten Überlegungen zur Erhöhung der Arbeitssicherheit jedoch belege, dass eben nicht von einem Vorsatz ausgegangen werden könne.
Fall kommt vors Landesarbeitsgericht
Das heißt, ins Alltagsdeutsch übersetzt: Der Fall fällt unter die Rubrik tragisches Schicksal, Geld gibt es für die Klägerin nicht. Für Thomas Daum handelt es sich dennoch um einen Grenzfall, den er dem Landesarbeitsgericht zur Bewertung vorlegen wird. Für ihn, der für gewöhnlich eher Arbeitgeber vor Gericht vertritt, handelt es sich zugleich um ein moralisches Anliegen. Deshalb auch hätte er das Verfahren gerne auf gütlichem Wege geklärt, doch das Unternehmen ging darauf nicht ein.
Recht und Moral
Bei Arbeitsunfällen greift für gewöhnlich das Unfallversicherungsrecht. Im Fall des Radolfzeller Arbeitsgerichts hat die zuständige Berufsgenossenschaft entsprechende Leistungen an die Klägerin erbracht. Die abgewiesene Klage bezog sich also auf etwaige zusätzliche Ansprüche. Nach Erfahrung von Thomas Daum werden die Diskrepanzen zwischen rechtlichen Ansprüchen und nachvollziehbaren Mehraufwendungen zumeist auf gütlichem Wege geregelt – zumal wenn es sich um langjährige Mitarbeiter handelt. Für seine Mandantin habe es jedoch "nicht einmal einen Blumenstrauß im Krankenhaus gegeben". Die Personalabteilung von Maggi wollte zur Verhandlung keine Stellungnahme abgeben, da es sich um ein laufendes Verfahren handle.