Sie sind nicht besonders groß, spielten in der Zeit des Zweiten Weltkriegs aber eine wichtige Rolle. In der Schweiz entlang der Grenze zu Deutschland stehen drei Bunker mit einst strategisch entscheidenden Funktionen. Einblicke in Bauwerke, die sonst verschlossen bleiben.
1. Schindlerbunker Strahler Bernau: Platz für ein Sprengkommando
Ganz unscheinbar steht er am Rande eines Maisfelds. Er hat schon bessere Tage gesehen. Der Eingang ist zugewuchert, und das Gras um den kleinen Bunker steht hoch. Eine Funktion hat er schon lange nicht mehr. Während des Zweiten Weltkriegs war seine Aufgabe noch elementar gewesen. Fritz Gehring vom Militär- und Festungsmuseum Full-Reuenthal erklärt die Aufgabe des Bunkers und zeigt, welcher Bunker eine weitere wichtige Rolle im Kanton Aargau hatte. Auch in Zürich gab es einen Bunker mit großer Bedeutung.
Heute ist die Sicht aus dem Bunker durch zugewachsene Bäume versperrt.

Während des Zweiten Weltkriegs bot der leicht erhöhte Bunker eine ungehinderte Sicht auf das Stauwehr des Rheinkraftwerks Albbruck–Dogern bei Leibstadt. Vom Vier-Personen-Bunker aus sollte im Falle eines deutschen Einmarschs in die Schweiz das Stauwerk gesprengt werden.
Warum war das Stauwerk strategisch so wichtig?
Das Stauwerk hätte es ermöglicht, das Staubecken dahinter trockenzulegen – eine einfache Möglichkeit, in die Schweiz einzumarschieren. Der Bunker war mit zwei leichten Maschinengewehren ausgestattet. Gebaut wurde der Schindlerbunker Strahler Bernau von 1938 bis 1939. Schindlerbunker sind getarnte, teils einbetonierte Kleinfestungen, die meist für Soldaten zur Infanterieabwehr und Beobachtung errichtet wurden.

2. Infanteriebunker Fullfeld-West: Teil des Verteidigungsgürtels
Ein einzelner Bunker hätte zur Verteidigung jedoch nicht ausgereicht. Entlang des Rheins findet sich ein langer Verteidigungsgürtel: das sogenannte Reduit-Verteidigungssystem.

Viele kleine Bunker sollten die Grenze sichern. Etwa der Infanteriebunker Fullfeld-West gehört dazu. Er war einer der ersten seiner Art, erzählt Fritz Gehring. Gleichartige Bunker findet man zuhauf in der ganzen Schweiz.

Der Infanteriebunker unweit des Kernkraftwerks Leibstadt wurde 1938 erbaut. Er verfügt über drei Schießscharten für Maschinengewehre – ursprünglich für das Maschinengewehr 11, später ersetzt durch das Maschinengewehr 51. Der zweistöckige Bau bot Platz für bis zu zwölf Soldaten.
3. Nur Koordination der Bunkeranlage Villa Arbenz
Ebenfalls Teil des Reduit-Verteidigungssystems ist die Bunkeranlage Villa Arbenz im Kanton Zürich. Sie gehört der Militärhistorischen Gesellschaft des Kantons Zürich. Sie trug eine ganz andere Aufgabe als die Bunker in Aargau.
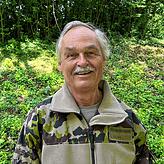
Drei Örtchen weiter neben dem Artilleriewerk Ebersberg liegt eine weitere große Bunkeranlage. 280 Meter fräst sie sich durch den Stein. Aber die Kommandoanlage Villa Arbenz war nicht auf Verteidigung ausgelegt. Erbaut wurde sie erst 1962. Gedacht wurde sie als die Koordinationsstelle vom militärischen Geschehen von den Kantonen Zürich und Schaffhausen. Geschützstände wie in Ebersberg gibt es hier nicht.

Keine Kanonen im Bunker
Trotz des anderen Nutzens ist der Bunker ähnlich zu Ebersberg aufgebaut. Ein langer Gang endet mit dem Blick in den Lauf eines leichten Maschinengewehrs. Die Temperatur misst nur 12 Grad und man ist tief im Inneren eines Bergs. Auch vom Aufbau ist sich noch vieles ähnlich. Erst Maschinen- und Tankraum und dann die Unterkunft. Nur ist hier die Unterkunft der Hauptpart der Festung. Die Kommandozentrale war für über 100 Soldaten ausgelegt.

Über zwei Stockwerke hätte in 19 Büroräumen das Kriegsgeschehen koordiniert werden können. Im Frühjahr 2020 übernahm die Gesellschaft den Bunker, wie Präsident Christian Egloff erzählt. Bis die Öffentlichkeit in den Bunker kommen konnte, vergingen noch zwei Jahre. Restauration und Corona verlangsamten den Prozess. Kurios – In dem Bunker waren ebenfalls 7000 Brieftauben beheimatet.






