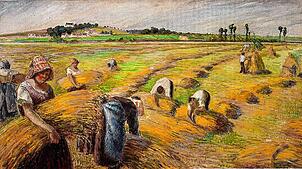Unrecht beklagen, das können viele. Amartya Sen, der am Sonntag den Friedenspreis des Deutschen Buchhandels erhält, kann mehr. Der Wirtschaftswissenschaftler und Philosoph liefert wissenschaftlich fundierte Theorien. Seine Beweisführung ist etwas für Spezialisten – seine Erkenntnisse indes leuchten auch Laien ein. Hier eine Auswahl.
- Zur Identität. Nationale oder religiöse Identität sind für Sen, salopp gesagt, ein Wahn. In Wirklichkeit ist kein Mensch nur Deutscher oder nur Christ. Ein und dieselbe Person kann südafrikanische Staatsbürgerin asiatischer Herkunft mit einem Job in Europa sein. Sie kann Christin, Sozialistin und Vegetarierin sein und zugleich davon überzeugt, das Wichtigste sei der Sieg ihres Lieblings-Clubs bei der Weltmeisterschaft. Die Identität eines Menschen stellt sich ebenso durch Alter, Geschlecht, Herkunft, Bildung, Einkommen, Milieu und Hobbys her. Vereinfacht gesagt: Ein deutscher Lehrer hat mit seinem indischen Kollegen vielleicht mehr gemeinsam als mit einem Frankfurter Banker. Identitätspolitik, die sich auf ein einziges Merkmal versteift, etwa nationale Zugehörigkeit, erzeugt künstlich Gegensätze und stiftet letztlich Gewalt.
- Zum Kampf der Kulturen. Der vom Politikwissenschaftler Samuel Huntington befürchtete weltweite „Kampf der Kulturen“ ist für Sen ein Konstrukt. Huntington, so Sen, reduziere Kultur auf religiöse Konzepte: Islamische Welt gegen jüdisch-christliche westliche Welt gegen buddhistische und hinduistische Welt. Statt solche Parallelwelten zu konstruieren, verweist Sen auf die Realität: auf die Interaktionen zwischen den Kulturen, auf querlaufende Interessen und Koalitionen. Statt die Furcht vor dem Fremden zu nähren, arbeitet Sen die Gemeinsamkeiten heraus.
- Zur Globalisierung. Dass die Globalisierung die Armen ein bisschen reicher (besser gesagt: weniger arm) macht, ist eine längst bewiesene Tatsache. Sen geht weiter. Er fragt nach gerechter Teilhabe: Wenn die weltweite Zusammenarbeit Gewinne abwirft, dann müssen diese Gewinne auch fair und akzeptabel verteilt werden. Alles andere stärkt die Globalisierungsgegner und den Rückzug ins Nationale.
- Zum Wohlstand. Wurde der Wohlstand einer Nation üblicherweise am Bruttoinlandsprodukt, Wirtschaftswachstum oder Konsum gemessen, so schuf Sen weitere Indikatoren. Er misst Wohlstand nicht nur an materiellen Gütern. Zentral sind für ihn zudem die Verwirklichungs-Chancen, also: Welche Möglichkeiten haben die Menschen, um das Leben, das sie führen möchten, zu verwirklichen? Dafür brauchen sie „instrumentelle Freiheiten“: politische Freiheiten (Wahlrecht), soziale Chancen (Bildung, Gesundheit), soziale Sicherheit (Arbeitslosenversicherung, Mindestlöhne), Transparenz (Pressefreiheit, Informationspflichten, z.B. gegen Korruption), ökonomische Institutionen ( z.B. Kartellamt oder Regeln für den Geld- und Güterverkehr).
- Zur Ungleichheit. Amartya Sen will mehr als nur Umverteilung und Gleichheit der Grundgüter. Er bezieht die unterschiedlichen Fähigkeiten der Menschen ein. Sein Beispiel: Trotz gleichen Einkommens kann ein Behinderter (auch ökonomisch) schlechter dran sein als ein Gesunder. Oder: Eine Person, die aus politischen Gründen im Hungerstreik ist, ist im Vorteil gegenüber einer Person, die aus Armut und Not hungert. Nach Abwägung aller Aspekte entscheidet sich Sen für ein auf Bedürfnissen und Fähigkeiten beruhendes System – und gegen ein nur auf Leistung und Verdienst beruhendes System.
- Zur Rationalität ökonomischen Verhaltens. Die klassische Nationalökonomie ging davon aus, dass Menschen sich rational entscheiden, orientiert am Eigennutz. In Wirklichkeit aber, so beharrt Amartya Sen, gibt es auch uneigennützige Handlungen, ohne die jedes politische und wirtschaftliche System zusammenbrechen müsste.
- Zur Frauenfrage. Amartya Sen rechnete als einer der ersten Wissenschaftler vor, wie viele Frauen weltweit statistisch „fehlen“, weil sie abgetrieben werden, früh sterben, schlecht entlohnt, versklavt, misshandelt oder gar ermordet werden. Sein Credo: „Nichts ist in der politischen Ökonomie der Entwicklung heute wichtiger als eine adäquate Würdigung der politischen, ökonomischen und gesellschaftlichen Teilhabe und Führungsrolle der Frau.“
- Zur Demokratie. Die Qualität einer Demokratie erweist sich nicht nur an ihren Institutionen, sondern: „Ihr Maß ist die Vielfalt der Stimmen aus unterschiedlichen Bereichen, die tatsächlich gehört werden können.“ Zum Wohlstand gehören für Sen die Entwicklungsmöglichkeiten, die ein Land auch seinen schwächsten Bewohnern eröffnet.
Sen versteht Demokratie als „Regierung durch Diskussion“ und misst sie am „öffentlichen Vernunftgebrauch“. Entsprechend wichtig sind ihm europäische Aufklärung, Meinungsfreiheit und qualifizierte Medien – aber ebenso nicht-westliche Philosophien, die Glaubenssätze unerbittlich überprüfen. Amartya Sen, Mittelsmann zwischen Ost und West, Ökonom von Weltrang.
Die ARD zeigt die Verleihung des Friedenspreises des Deutschen Buchhandels am Sonntag ab 10.45 Uhr live. Die Laudatio hält Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier.