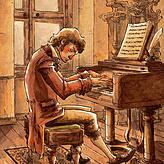Erst einmal Gratulation! Ihre Frau Aleida und Sie werden in den höchsten Wissenschaftsorden aufgenommen – den Pour le Mérite der Friedensklasse.
Keine Ahnung, wie so etwas kommt. Es ist für mich etwas unheimlich. Viele Leute, die ich hoch verehre, sind nicht Mitglied in diesem Orden, ich denke da an Jürgen Habermas und andere Größen. Beim Friedenspreis vor zwei Jahren war es ähnlich. Bei meiner Frau Aleida gehen diese Ehrungen in Ordnung; sie schreibt ja Bücher, in denen sie interveniert und das öffentliche Leben bereichert. Aber ich? Wie dem auch sei, ich freue mich auf die Auszeichnung. Im kommenden Jahr empfangen wir die Insignien.
Herr Assmann, von Haus aus sind Sie Fachmann für die Jahrtausende der Hieroglyphen, Sie sind namhafter Ägyptologe. Doch nun legen Sie ein Buch über Ludwig van Beethoven vor. Das ist ein Sprung.
Als Schüler habe ich mich nur für Musik interessiert und wollte später Musikwissenschaft studieren. Doch nach dem Abitur verließ mich der Mut. Ich entschied mich für Archäologie und bin später in die Ägyptologie gerutscht. Es begann das Studium der Keilschriften und Hieroglyphen. Da blieb ich hängen. Doch die Leidenschaft galt immer der Musik.
In Ihrem neuen Buch stellen Sie eine spektakuläre These auf: Die Missa Solemnis von Beethoven markiere den Beginn einer Kunstreligion. Was heißt das?
Als Beethoven im Jahr 1770 geboren wurde, war die Aufklärung voll im Gange. Die christliche Religion galt als verblasst. Der kirchliche Glaube war stark in den Hintergrund gedrängt von Schriftstellern wie Voltaire in Frankreich oder Lessing in Deutschland. Das Heilige gab es noch, aber es verlagerte sich auf andere Gebiete.
Wohin denn?
In die Kunst und in die Nation hinein. Erst etablierte Frankreich seinen Kult der Nation, später folgten auch die deutschen Länder, z. B. mit dem Begriff des „heiligen Vaterlandes“.
Doch wie kann Kunst zur Religion werden? Woran glaubt man denn dann?
Es beginnt mit den Komponisten. Händel wurde in England geradezu vergöttert. Zu Lebzeiten wurden ihm Statuen errichtet. Um seine Person wurde ein Kult entfacht. Seine Werke wurden nach seinem Tod fleißig weitergespielt. So war Händel omnipräsent in seinen Oratorien – anders als ein Johann Sebastian Bach, dessen Vokal-Werke nach seinem Tod schlicht vergessen wurden, bis er im 19. Jahrhundert neu entdeckt werden sollte. Bei Händels Konzerten musste Schweigen herrschen.

Ist das nicht selbstverständlich, wenn man Musik hört?
Nein, zu Mozarts Zeiten wurde während der Konzerte geplaudert. Die Stille und Andacht während der Musik entwickelte sich erst im 19. Jahrhundert. Sie ist uns bis heute geblieben.
Wo ist dann der spirituelle Sprung in Beethovens Leben?
Er verstand sich zunehmend als öffentlicher Künstler. Mit seinen Sinfonien und Klavierkonzerten wollte er ein großes Publikum erreichen und seine Ideen vermitteln, die er aus seiner Leidenschaft für die Ideen der Revolution in Frankreich gewonnen hatte. Das Religiöse kommt erst später. In den Jahren 1812 bis 1818 schreibt er an einem Tagebuch, in dem er sich auch mit Gott auseinandersetzt. 1818 passiert etwas Wichtiges: Ein Freund, Mäzen und zugleich prominenter Schüler des Komponisten war Erzherzog Rudolf. Dieser Habsburger wurde zum Erzbischof von Olmütz (heute Tschechien) berufen. Beethoven wollte dafür eine Messe komponieren, zur Untermalung der Amtseinführung.
Welche Rolle spielt die Taubheit bei Beethoven? Als er diese große Messe schrieb, hörte er nicht mehr.
Er arbeitete mit seinem inneren Gehör. Das hat er kultiviert. Seine klangliche Vorstellungskraft war beim ihm extrem differenziert ausgebildet, anders wären diese schöpferischen Leistungen nicht möglich gewesen. Bereits in den Klaviersonaten ist zu spüren, welche Skala zwischen Zartheit und Gewalt er ausschöpft, obwohl er keinen Ton mehr hört. Inneres Hören funktioniert also. So hat er auch die Partituren seiner Kollegen lesen und aufnehmen können, wenn er das wollte.
Wurde diese Messe jemals im Gottesdienst gespielt?
Sie sollte eigentlich bei Rudolfs Investitur zum Erzbischof erklingen. Doch beim Schreiben merkte er dann, dass ihm die Messe unter den Fingern wächst. Die Messe wurde nicht fertig. Das war für Beethoven ein Nachteil, schließlich hätte er zu einem Posten als Kapellmeister in Olmütz kommen können unter seinem alten Gönner. Darauf verzichtete er, seine Idee einer religiös überformten Musik „wahrer Kirchenmusik“ hatte Vorrang. Ab dem Gloria, dem zweiten Satz, dachte er nicht mehr an einen kirchlichen Rahmen. Seine Musik sollte nicht den Gottesdienst verschönern, sondern selbst vollziehen. Die Musik selbst wurde Gottesdienst, für den man keinen sakralen Raum mehr benötigte.
Hat er sich mit anderen Komponisten seiner Zeit auseinandergesetzt ?
Ich habe aber nicht den Eindruck, dass er sich viel mit zeitgenössischen Musikern und deren Werken beschäftigt hat. Cherubini hat er hoch geschätzt. Bach, Haydn, Mozart hat er studiert, Händel aber war für ihn der größte Komponist, der je gelebt hat. In seiner Zeit stand er als Monolith – bis heute.
Welchen Musiker werden Sie als nächsten aufgreifen?
Ich verfolge keine weiteren Pläne. Ich werde eine produktive Pause einlegen. Mit 82 Jahren gönne ich mir das einfach.