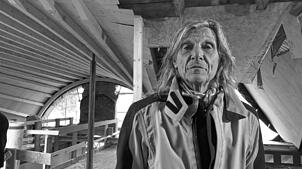Die Bewegung ist Vergangenheit, sie hat nur zweieinhalb Jahre existiert: Anfang Mai ist der Lieferdienst Gorillas endgültig vom Markt verschwunden – wie Getir, Grovy, Frischepost, Frichti, Getfaster und wie die anderen Quick-Commerce-Anbieter alle hießen. Sie waren mit dem Versprechen angetreten, dass man künftig alle seine Einkäufe per App erledigen könne und die bestellten Waren dann binnen weniger Minuten von einem freundlichen Fahrer an die Haustür geliefert bekomme.
Vielversprechender Anfang
Und tatsächlich hatte ja auch alles vielversprechend angefangen, damals während des Corona-Lockdowns, als die Liefer-Start-ups auf den deutschen Markt drängten und die ansonsten leergefegten Großstädte plötzlich bevölkert waren von bunten E-Bikes, auf denen ebenso farbenfoh gekleidete Kuriere durch die Straßen heizten. Die Idee von Gorillas-Gründer Kagan Sümer, die Lebensmittel zu den Menschen zu bringen, wenn der umgekehrte Weg nun einmal virushalber versperrt ist, schien erfolgversprechend.
In internen Meetings, deren Mitschnitte „Süddeutsche Zeitung“ und das ARD-Magazin „Panorama“ publik machten, sieht man, wie Sümer seinen Mitarbeitern zuruft, man habe „eine Bewegung geschaffen“. In 20 Jahren werde man sagen: „Wir haben verdammt noch mal das neue Nike gebaut. Wir werden einen Einfluss von vergleichbarem Ausmaß haben.“ Die Start-ups wollten die Revolution des Einkaufens bewerkstelligen. Und sind damit einstweilen gründlich gescheitert.

Das dürfte auch daran liegen, dass sie ihr Zukunftsversprechen von Beginn an nicht einhalten konnten. Es lautete, dass in naher Zukunft auch in ländlichen Regionen wie im Schwarzwald oder am Bodensee niemand mehr selbst einkaufen gehen müsse, weil das die freundlichen Fahrer des eigenen Lieferdienstes übernehmen würden. Doch den Schritt aufs Land wagte niemand, und selbst in den Metropolen arbeitete man nicht wirtschaftlich. 2022 betrug bei Gorillas der Wert einer durchschnittlichen Bestellung nur 27,20 Euro, pro beliefertem Kunden machte man 5,30 Euro Verlust.
Kaum soziale Absicherung
An den Lohn- und Lohnnebenkosten hat das wohl eher nicht gelegen. Die Lieferdienste setzten fast ausschließlich auf Solo-Selbständige, Schüler und Studierende: kaum soziale Absicherung, dafür aber ein hohes Maß an Unsicherheit und gleichzeitig umfassende Kontrolle. Wer aufbegehrte, hatte schlechte Karten: In Berlin hat Gorillas streikende Fahrer „aus wichtigem Grund“ rausgeschmissen. Und damit ein Drohszenario aufgebaut, das wirkt. „Wir sind in der Branche fast nicht vertreten, Betriebsräte sind ein Fremdwort“, sagt der Stuttgarter Verdi-Sprecher Wolfgang Krüger. „Gerade Neugründungen sperren sich oft jahrelang dagegen, dass Arbeitnehmer ihre Interessen vertreten.“
Und das europaweit: Von den gut 500 Plattformen, die 2021 in der EU aktiv waren, beschäftigten mehr als 90 Prozent ausschließlich Selbständige. Die Branche sei „auf dem besten Weg, zum Symbol einer neuen Form von Arbeitnehmerausbeutung zu werden“, kommentierte die „Süddeutsche Zeitung“ damals. Doch auch das Sozial-Dumping brachte offenbar nicht den gewünschten Erfolg. „Wir haben uns komplett überschätzt“, gab ein ehemaliger leitender Gorillas-Mitarbeiter, Seif El-Sobky, bei „Panorama“ an. „Zu der Zeit dachten wir, dass wir alles tun können, was wir wollen.“
Größenwahn und fehlende Expertise
Das gleiche Phänomen, eine Mixtur aus Größenwahn und fehlender Expertise, attestiert der Ökonom Carsten Kortum von der Dualen Hochschule Heilbronn auch anderen Branchen-Start-ups. Die meisten von ihnen, sagte er der Wochenzeitung „Die Zeit“, hätten „unterschätzt, wie knallhart der Preiskampf im Lebensmittelhandel geführt wird“. Denn natürlich hätten auch die Discounter mit dem Liefer-Geschäftsmodell Quick Commerce geliebäugelt. Doch die hätten das „penibel durchgerechnet und festgestellt, dass das Modell nicht rentabel ist“.
Tatsächlich hat beispielsweise Branchenriese Rewe den Markt jahrelang analysieren lassen und war damit besser vorbereitet als die Start-ups. Das Resultat war ein Liefermodell ohne das Versprechen, in Minutenschnelle zu liefern. So können Touren zusammengelegt werden, Sprit- und Personalkosten betragen einen Bruchteil dessen, was die hippen Anbieter bezahlen, die für jede Palette H-Milch einen eigenen Fahrer von A nach B schicken müssen.
Doch auch das Rewe-Geschäftsmodell bietet keine gute Nachricht für Bewohner des ländlichen Raums. Auch die sind bei Rewe nämlich außen vor. Sie können online oder per Telefon zwar bestellen, bekommen die Waren aber zugeschickt. Der zweite deutsche Supermarkt-Riese Edeka bietet in seinem Online-Shop Edeka24 nur Haltbares an, also weder Gemüse, Obst noch Fleisch. Versandt werden die Lebensmittel mit der DHL – kostenfrei allerdings erst ab 75 Euro.
Discounter betreiben selbst Bestell-Modelle
Doch während Rewe mittlerweile seit zwölf Jahren einen Lieferdienst betreibt und auch die meisten anderen Discounter erfolgversprechende Bestell-Modelle entwickelt haben, setzte sich bei den Quick-Commerce-Anbietern wie Gorillas das Sterben auf Raten fort. Erst zog man sich aus Ländern wie Italien und Belgien zurück, dann schlossen in Deutschland und den Niederlanden nach und nach die Warenlager, auch die Kooperation mit Getir (ab Dezember 2022), brachte nichts mehr. Das Unternehmen mit Sitz in Istanbul gab nun im Mai zeitgleich mit Gorillas den Rückzug aus dem Europa-Geschäft bekannt.
Selbst in den größeren Städten, auf die sich Gorillas und Co. beschränkt hatten, hat sich der erwünschte Erfolg nicht eingestellt. Zwar wurden die braunen Gorillas-Tüten von Hamburg bis Stuttgart in so manche Studenten-WG geliefert, die das Versprechen attraktiv fanden, innerhalb von zehn Minuten die Nudeln fürs Abendessen und das gekühlte Bier zur Party danach geliefert zu bekommen.
Das Lebensgefühl von Teilen einer Generation, die das Handy als Pforte für quasi sämtliche Lebensbereiche nutzen, trafen die Quick-Commerce-Anbieter also in Teilen durchaus. Und offenbar war diese Zielgruppe auch eher bereit, die offenen und versteckten Mehrkosten für die schnelle Lieferung zu bezahlen. Die meisten Produkte sind bis zu 15 Prozent teurer als im Supermarkt. Dazu kommen die Liefergebühren, die vor allem bei kleinen Liefermengen happig waren.
Ältere zeigen anderes Konsumverhalten
Ein völlig anderes Konsumverhalten zeigen hingegen die Älteren, eigentlich die größte potenzielle Abnehmergruppe für Lieferwaren. Senioren finden den Gang zum Supermarkt zwar mit fortschreitendem Alter immer beschwerlicher. Doch offenbar lassen sie sich lieber von vertraut klingenden Märkten wie Rewe beliefern, in denen sie zuvor auch selbst eingekauft haben. Zumal der die Bestellungen auch per Telefon entgegennimmt. Dass der nicht unmittelbar nach Eingang der Bestellung lossprintet, finden ältere Menschen offenbar nicht schlimm. Rewe liefert seit Neuestem einmal die Woche gratis, ansonsten kostet die Lieferung maximal 5,90 Euro.
Derweil steht mit dem Ende von Getir und Co. ein Geschäftsmodell in Frage, das auf der Annahme beruht, dass eine große Zahl von Menschen bereit ist, für sofort gelieferte Waren mehr Geld zu bezahlen. Bestätigt fühlen können sich deshalb Wissenschaftler wie der Leipziger Professor für Marketing und Handel, Erik Maier, der schon 2022 eine Marktbereinigung prophezeit hatte. Unter den großen Quick-Commerce-Anbietern ist einstweilen nur Flink übrig geblieben.