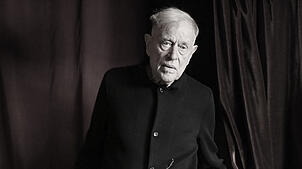Herr Pollanz, Sie lehren und forschen an der HTWG Konstanz über Komplexität und „bösartige“ Probleme. Inwiefern haben wir es bei der Corona-Krise mit einem „bösartigen“ Problem zu tun?
Das Attribut „bösartig“ verweist natürlich zunächst auf die gesundheitlichen Gefahren, die von dem Virus ausgehen: Ältere Menschen und solche mit geschwächtem Immunsystem sind besonders gefährdet. Doch es zeigt sich, dass das Virus schon seit seiner Entdeckung kein bloß eindimensionales medizinisches Problem eines fehlenden Impfstoffes darstellte. Als das Virus erstmals in China auftrat, waren die damit verbundenen Folgeprobleme in einer globalisierten und hochmobilen Welt vorprogrammiert.
Was macht denn ein Problem zu einem „bösartigen“ Problem?
Im Unterschied zu „zahmen“ Problemen, die grundsätzlich lösbar sind, wofür es Anleitungen, Checklisten und Programme gibt, lässt sich ein „bösartiges“ Problem in seiner ganzen Komplexität und Tragweite kaum managen, solange es keine Lösung wie einen Impfstoff gibt. Es handelt sich dabei um ein Problem mit verschiedensten Facetten und kaum zu überschaubaren Verkettungen und Folgeproblemen. Es gibt keinerlei Erfahrungen, auf die wir zurückgreifen können. Der Dramatiker Friedrich Dürrenmatt hat es einmal auf den Punkt gebracht: „Je planmäßiger die Menschen vorgehen, desto wirksamer trifft sie der Zufall.“

Gibt es Beispiele für andere bösartige Probleme?
Ja. Der Klimawandel ist ebenfalls ein solches bösartiges Problem. Und der Finanzsektor in seiner aktuellen Ausprägung auch. Da steigen auch Experten kaum mehr durch.
Wir erleben, dass wir die Corona-Krise nicht einfach stoppen – das Virus ist uns immer schon weit voraus.
Das stimmt. Es erfasst blitzartig sämtliche Lebensbereiche. Dieses Phänomen ist auf die starke Vernetzung zurückzuführen und wird in meinem Forschungsgebiet als „Tele-Coupling“ bezeichnet. Auf diese Weise werden also nicht nur Menschen, sondern sämtliche Lebenskontexte „viral“ infiziert und irritiert. Das Problem breitet sich schneller aus, als Antworten darauf gefunden werden. Ich nenne das „Time Lag of Response“. Man hinkt ständig hinterher und der Druck auf die politischen Entscheider wird stündlich größer. Der „Time Lag of Response“ erzeugt extreme Zusatzkosten, die schon jetzt nicht mehr überschaubar, geschweige denn bezifferbar sind. Daher auch die extreme Volatilität an den Börsen.
Müssten wir also beginnen, völlig anders zu denken im Umgang mit dieser Krise?
Ja, denn unser fehlendes Bewusstsein für die Komplexität der Corona-Krise und auch unser fehlendes Wissen, wie wir damit umgehen sollen, all dies erzeugt in der nächsten Stufe der Eskalation Kosten, die ein System schließlich zur Implosion bringen können.
Wie sähe eine solche Implosion denn aus?
Im Finanzsektor tickt eine Zeitbombe. Die Märkte haben jeglichen Bezugspunkt verloren.
Was heißt das konkret?
An den Kapitalmärkten werden ja gewissermaßen Erwartungen verhandelt. Doch im Moment erleben wir einen Crash dieser Erwartungen, weil wir gar nicht wissen, wie es weitergeht. Insofern fehlt jede Referenz, auf die ich meine Erwartung am Kapitalmarkt beziehen kann.
Was müssten wir also tun?
Im Umgang mit einem bösartigen Problem gibt es kein „richtig“ oder „falsch“, sondern nur „gut“ oder „schlecht“ beziehungsweise „gut genug“ oder „nicht gut genug“. Das Corona-Virus führt uns vor Augen, dass es ein fundamentaler Irrglaube ist anzunehmen, dass Probleme dazu da sind, gelöst zu werden. Lösen lässt sich eine mathematische Gleichung oder ein verstopftes banales Abflussrohr. Die entscheidende Frage lautet daher: Wie schaffen wir es, dass wir alle ein möglichst adäquates, der Komplexität und Gefährlichkeit der Corona-Situation angemessenes Problemverständnis entwickeln.
Immer mehr Menschen halten sich an die neuen Vorschriften. Doch für die nationale und weltweite Wirtschaft ist noch nicht absehbar, wohin es geht.
Die globale Wirtschaft befindet sich in einer fast schon apokalyptischen Mega-Schockstarre. Wir erleben abrupte Angebots-, Nachfrage-, Liquiditäts- und Finanzschocks und das synchron und auf sämtlichen Ebenen: also lokal, global, branchen- und gesellschaftsübergreifend. Das stellt alles bisher Dagewesene in den Schatten! Die von der Politik in Aussicht gestellten Liquiditätshilfen, Überbrückungskredite und Gelder für Kurzarbeit werden aber, so viel steht fest, bei weitem nicht ausreichen, um die Wirtschaft auch nur einigermaßen zu stabilisieren. Und wer soll die zu erwartende Flut an Anträgen in unserem extrem bürokratischen „System“ bewältigen? Das wird uns an die Grenzen der Handlungsfähigkeit bringen.
Was muss Ihrer Meinung nach getan werden, damit wir handlungsfähig bleiben?
Die Politik muss unbedingt bürokratische Hemmnisse abschaffen. Wir sollten schleunigst auf einen „adhocratischen“ Ansatz umsteigen, sonst laufen sämtliche Programme zur Stabilisierung der Wirtschaft ins Leere. Bis all die Anträge bearbeitet sind und zeitraubende bürokratische Prozesse durchlaufen haben, sind zwischenzeitlich viele Unternehmen und Unternehmer insolvent, das heißt im schlimmsten Fall brechen ganze Strukturen weg und gehen unwiederbringlich verloren.
Welche bürokratischen Hemmnisse wären das?
Nehmen Sie zum Beispiel Kreditinstitute, da geht es ja auch um Haftungsfragen, die einer zügigen Abwicklung von Liquiditäts- und Kredithilfen massiv entgegenstehen. Die Banken müssen sich zum Beispiel nach wie vor mit Rating-Fragen beschäftigen und die Kreditwürdigkeit beurteilen. Das dauert viel zu lange. Eine zeitweise Lockerung von Kreditlinien wäre eine einfache und schnell wirksame „Adhoc“-Maßnahme, statt die Betroffenen umständliche und zeitraubende Anträge ausfüllen zu lassen. Das wäre gerade auch für Hotel- und Gaststättenbetriebe und den Einzelhandel in unserer Region wichtig. Die zugesagten Hilfen müssen schneller bei den Betroffenen ankommen, um Ängste abzubauen.
Im Moment sind hauptsächlich Politiker und Virologen in die Entscheidungsfindung involviert. Reicht das aus?
Nein. Wir brauchen ein interdisziplinäres Team, erweitert um beispielsweise Psychologen, Ökonomen, Soziologen, Philosophen, Journalisten, aber auch Laien im Sinne einer gesellschaftsübergreifenden „Task Force“. Im Umgang mit bösartigen Problemen gibt es nicht den einen Experten, vielmehr ist die Expertise auf viele Köpfe verteilt. Wenn es bei uns im Gesundheitssektor eng werden sollte, so wie wir es in Italien erleben, dann tauchen ethische Fragen auf. Man sollte nicht warten bis es soweit ist, sondern sich unbedingt vorab mit solchen Fragen beschäftigen.