Herr Seibel, warum heizt Trump den Rassismus in den USA an? Glaubt er davon für die Wahl zu profitieren?
Nein, das ist nicht meine Einschätzung. Ich glaube, dass er auch in diesem Fall nicht begreift, was die Rolle eines Präsidenten, eines verantwortlichen Politikers, sein muss. Wenn gesellschaftliche Spannungen schon so eskaliert sind, müssen Politiker die Spannungen milder, integrierend wirken, sich ausgleichend äußern. Das ist wohl etwas, das in der Psyche von Trump gar nicht existiert.
Wie schätzen Sie seine Chancen ein, im November wiedergewählt zu werden?
Es gibt ein Zitat von einem Baseballtrainer: „Ich mache keine Vorhersagen, insbesondere nicht über die Zukunft.“ Wir haben uns 2016 geirrt, als alle Meinungsforscher sich einig waren, dass Hillary Clinton gewinnt. Politikwissenschaftler sind vorsichtig geworden mit Prognosen. Derzeit liegt Biden in den Umfragen vorne, aber es kann noch viel passieren.
Hat er sich mit dem schlechten Umgang mit der Coronakrise und nun mit den Floyd-Protesten nicht unmöglich gemacht?
Unmöglich hat er sich längst gemacht, schon bevor er gewählt wurde. Eine entscheidende Frage ist die Republikanische Partei als solche. Wir sehen klare Erosionserscheinungen, zuletzt mit dem Konflikt mit James Mattis und wie der Präsident mit seinem ehemaligen Verteidigungsminister umgeht. Der am meisten überbewertete General in der US-Geschichte hat er ihn genannt, obwohl er einer der engsten Gefolgsleute von Trump war. Die Frage ist, ob die Republikaner es fertigbringen, sich von diesem Präsidenten zu distanzieren. Aber sie haben schon damals zugelassen, dass er kandidiert, trotz allem.
Ist Rassismus, wie wir ihn in den USA seit Jahrzehnten erleben, so in Deutschland vorstellbar?
Der Rassismus in den USA betrifft vor allem Bürger schwarzer Hautfarbe. Das ist die Erblast der Sklaverei. Dieser Rassismus ist so hartnäckig, weil er vor allem struktureller Natur ist, ein Teufelskreis aus ursprünglicher Diskriminierung, begrenztem Zugang zu höheren Bildungseinrichtungen, schlechteren Jobs, Gettobildung in den Großstädten und begrenzte Chancen für sozialen Aufstieg.
Ähnliche Phänomene haben wir auch in Europa, zum Beispiel in den Pariser Vorstädten. Dagegen haben wir in Deutschland eine deutliche Zunahme des ideologischen Rassismus, also fremdenfeindlicher und vor allem auch wieder antisemitischer Einstellungen. Wir hatten eine rassistische Mordserie in Deutschland durch den NSU und wir haben wieder Anschläge auf Synagogen.
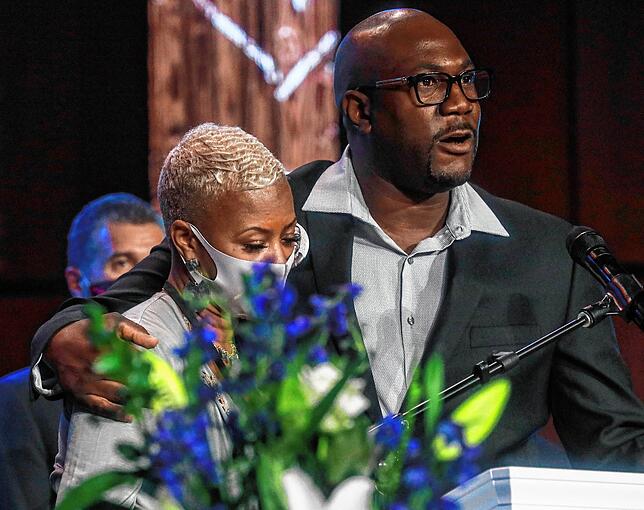
Was wäre, wenn wir in Deutschland eine so starke ethnische Diversität hätten wie in den USA?
Dann könnten wir gerade im Arbeitsleben und in der Politik viel von den USA lernen. Das sogenannte Diversity Management ist eine amerikanische Erfindung. Betriebe verpflichten sich, die Vielfalt der Gesellschaft in ihrem Personalbestand abzubilden. Ich habe deutsche Manager in den USA getroffen, die sich darüber lustig machten.
Und wir erleben derzeit in den USA eine Mobilisierung gegen rassistische Gewalt, wie wir das in Deutschland noch nicht gesehen haben. Nicht nach dem Anschlag auf die Synagoge in Halle und auch nicht nach Bekanntwerden des wahren Hintergrunds der NSU-Morde. Wir haben also keinen Anlass zu Selbstgerechtigkeit, wenn es um Rassismus geht, und leider auch nicht zu Optimismus, was unsere Fähigkeit zum Umgang mit zunehmender ethnischer Diversität betrifft.
Besteht eine latente Gefahr, dass der Rassismus hierzulande nach der Flüchtlingskrise und nun der Angst vor dem Coronavirus, verstärkten Hass gegen Ausländer oder Deutsche mit ausländischen Wurzeln schürt?
Ich würde es positiv wenden: Wir haben alles Anlass, darüber nachzudenken und öffentlich zu reden, ob die Coronakrise nicht die ohnehin Schwachen und Benachteiligten weiter benachteiligt. Und dazu gehören eben auch die Ausländer und viele Deutsche mit ausländischen Wurzeln.
Denken wir nur an die Schulen: Wer schon unter normalen Umständen zu Hause nicht die Unterstützung einer deutschen Bildungsbürgerfamilie hat, wird jetzt beim Online-Lernen erst recht abgehängt, wenn die Wohnverhältnisse beengt sind und sich mehrere Kinder einen Laptop teilen müssen, wenn sie denn überhaupt einen zur Verfügung haben. Wir sehen derzeit viel Solidarität und gesellschaftlichen Zusammenhalt, warum soll das nicht auch den Menschen mit dem viel zitierten Migrationshintergrund zu Gute kommen. Das muss man nur politisch organisieren.








