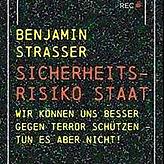Herr Strasser, der Verfassungsschutz hat entschieden, einzelne Querdenker zu beobachten. Für wie gefährlich halten Sie die Bewegung?
Wir erleben bei den Querdenkern seit Monaten eine spür- und sichtbare Radikalisierung. Anhänger der Bewegung schrecken auch nicht vor Gewalt zurück. Journalisten und Polizisten werden angegriffen, ein Anschlag auf das Robert-Koch-Institut verübt. Das ist Extremismus einer neuen Form, den man nicht so einfach in rechtsextrem, linksextrem oder religiös motiviert einordnen kann.
Dieses „Querfront-Prinzip“ vereint Reichsbürger, Rechtsextremisten, Antisemiten, Verschwörungstheoretiker jeglicher Couleur und Esoteriker in dem Ziel, die Demokratie zu destabilisieren, sie verächtlich zu machen, indem gewählte Regierungen und Parlamente mit diktatorischen Regimes verglichen werden. Deshalb ist es richtig, dass der Verfassungsschutz im Bund jetzt innerhalb der Bewegung die Extremisten beobachtet.
Gibt es die auch im Südwesten? Immerhin hat Michael Ballweg die Bewegung hier gegründet…
Ja. Baden-Württemberg ist sogar ein Hotspot der Querdenker. Es sind teilweise sehr radikale Personen dabei. Bei den Demonstrationen reisen bundesweit bekannte Neonazis an. Man sieht dort rechtsextreme Parteien wie die NPD oder den III. Weg sowie QAnon-Verschwörungsanhänger. Das Landesamt für Verfassungsschutz hat Querdenken deshalb schon vor mehreren Monaten als Beobachtungsobjekt eingestuft.
Für wie gefährlich oder harmlos halten Sie Ballweg?
Gerade der Gründer Michael Ballweg gibt sich gerne harmlos, sucht aber offensiv den Anschluss an die rechtsextreme Reichsbürgerszene. Auch die Finanzierung von Querdenken ist undurchsichtig und wirft Fragen auf. Das ganze Geld läuft wohl über das Privatkonto von Herrn Ballweg.
QAnon kommt ja ursprünglich aus den USA und hat mit Corona nichts zu tun. Wieso erlebt die Bewegung derzeit in Deutschland offensichtlich einen Zustrom? Sind sie eher harmlose Verschwörungstheoretiker oder eine handfeste Bedrohung für unseren Staat?
QAnon ist tatsächlich eine wachsende Bewegung. Die Anhänger glauben an eine große weltweite Verschwörung der sogenannten Eliten. Vieles davon ist angelehnt an antisemitische Verschwörungserzählungen, die es bereits im Mittelalter gab. Corona ist dabei nur der Aufhänger, um zu beweisen, dass diese geheimen Mächte die Menschheit kontrollieren wollen. Das ist brandgefährlich, weil es das Vertrauen in die Demokratie und deren gewählte Institutionen und Entscheidungen untergräbt. Vielen Bürgern ist gar nicht bewusst, welche extremistischen Organisationen seit Längerem die Querdenken-Bewegung unterwandern.
Macht dieses Unbewusstsein die Bewegung umso gefährlicher?
Das ist sicher gefährlicher als die klassischen Neonazis der 1990er Jahre, die für die Bürger bereits optisch erkennbar waren und mit denen man nichts zu tun haben wollte und will. Die Extremisten innerhalb von Querdenken gehen aber subtiler vor. Sie behaupten, die einzig echte Opposition zu sein, die Kritik an den Regierungspolitik übt. Das ist natürlich Humbug. Innerhalb des Bundestags gibt es seriöse Oppositionsparteien.
Denen die FDP angehört...
Als Freie Demokraten gehen wir regelmäßig hart mit der Corona-Politik der Bundesregierung ins Gericht. Ich klage mit vielen Fraktionskollegen gerade vor dem Bundesverfassungsgericht gegen die Bundesnotbremse und die Ausgangssperren. Kritik an der Corona-Politik bedeutet aber nicht das Recht zu haben, über extremistische Positionen, die Demokratie abschaffen zu wollen. Hier muss ein Rechtsstaat wehrhaft sein.
Wie groß ist die Gefahr von rechtem Terror?
Die Gefahr von rechtsterroristischen Anschlägen ist nach wie vor groß. Die Mordserie des Nationalsozialistischen Untergrunds war kein singuläres Geschehen. Seit dem Jahr 1990 sind knapp 200 Menschen von Rechtsextremisten in Deutschland ermordet worden. Allein in den Jahren 2019 und 2020 haben wir mit dem Mord an Dr. Walter Lübcke sowie den Attentaten von Halle und Hanau drei rechtsterroristische Anschläge in kurzer Zeit erlebt.
Allen Tätern ist gemein, dass sie sich bei ihren Taten auf gängige rechtsextreme Verschwörungserzählungen und einen vermeintlichen Volkswillen berufen. Deshalb haben wir auch als Gesellschaft eine Verantwortung, der teils entgrenzten Sprache Einhalt zu gebieten. Sorge macht mir auch, dass wir immer mehr rechtsextreme Netzwerke innerhalb von Sicherheitsbehörden feststellen müssen.
In Stuttgart läuft die Verhandlung gegen die sogenannte Gruppe S, deren Mitglieder auch der Gruppierung „Wotans Erben Germanien“ zugehörig gewesen sind. Ihr „Anführer“ lebt in der Region. Wie sind solche Gruppierungen einzuordnen?
„Tag X“-Szenarien, also der Tag, an dem die staatliche Ordnung zusammenbricht, sind in der rechtsextremen Szene schon immer allgegenwärtig. Wann dieser „Tag X“ da ist und was ihn auslöst, ist dabei unbestimmt und liegt oft in der Einschätzung einzelner Personen in der Szene. Bei der Gruppe S. haben sich solche Personen zusammengetan und waren schon sehr konkret in der Planung.
Wie konkret, zeigt die derzeitige Gerichtsverhandlung...
Man wollte zeitgleich, aber dezentral, Politiker ermorden und auch Moscheen angreifen, um so Racheaktionen zu provozieren. Über daraus resultierende bürgerkriegsähnliche Zustände sollte der „Tag X“ also künstlich herbei geführt werden. Ziel ist immer die Abschaffung der Demokratie. Die Gruppe Nordkreuz ist ein ähnlicher Fall, der in der jüngeren Vergangenheit aufgetreten ist. Erschreckend ist, dass in den Gruppen auch ehemalige und aktive Polizisten und Soldaten beteiligt sind.
Rechter Terror ist zurückgekehrt, islamistischer seit Jahren eine Bedrohung. In Deutschland geht man von etwa 600 Gefährdern aus. Anfang des Jahres gab es eine große Razzia, möglicherweise wurde ein Anschlag verhindert. Kann man das als Erfolg oder Lehre aus dem Anschlag durch Anis Amri in Berlin werten?
Es ist immer gut, wenn die Sicherheitsbehörden rechtzeitig eingreifen und Anschläge verhindern. Im Fall des Anschlags auf dem Berliner Breitscheidplatz war das tragischerweise nicht so. Anis Amri war der Top-Gefährder des Jahres 2016. Die Sicherheitsbehörden hatten weitreichende Informationen über ihn und trotzdem wurde er nicht aus dem Verkehr gezogen.
Ich hätte mir nach der Mordserie des NSU nicht hätte vorstellen können, dass innerhalb weniger Jahre die gleichen Fehler durch Sicherheitsbehörden wieder begangen werden. Es handelt sich offensichtlich um ein systematisches Versagen. In beiden Fällen waren beispielsweise die Täter von Vertrauenspersonen, also Spitzeln, der Sicherheitsbehörden beinahe umzingelt. Informationen, die in den Behörden vorhanden waren, wurden nicht oder nur unzureichend weitergeleitet. Amri war im Prinzip die heiße Kartoffel, die keine Behörde haben wollte.
Bei der Aufarbeitung des Anschlags war oft von Behördenversagen die Rede. Geändert hat sich wenig. Was bemängeln Sie an der bisherigen Struktur?
Wir haben zu viele Sicherheitsbehörden und eine Sicherheitsarchitektur aus den 1950er Jahren. Rund 40 Behörden in Bund und Ländern sollen für unsere Sicherheit sorgen. Teils so klein, dass sie den terroristischen Herausforderungen des 21. Jahrhunderts nicht mehr wirksam begegnen können. Ein Update dieser Sicherheitsarchitektur gab es nie.
Beim NSU-Komplex wie auch im Fall Amri waren zwar viele zuständig, aber als es drauf ankam niemand verantwortlich. Wir brauchen dringend eine echte Reform unserer Sicherheitsarchitektur mit dem Ziel, durch weniger Behörden mehr Sicherheit zu organisieren.
Immerhin gibt es das Terrorismusabwehrzentrum. Aber auch da arbeiten ja faktisch verschiedene Einzelbehörden zusammen und tauschen sich bestenfalls aus…
Das Gemeinsame Terrorismusabwehrzentrum (GTAZ) war eine Lehre aus dem 11. September 2001. Diese Anschläge haben sichtbar gemacht, wie international vernetzt der Terrorismus im 21. Jahrhundert und auch, dass unsere föderale Struktur darauf nicht vorbereitet ist. Das GTAZ war und ist also ein erster Schritt. Es ist aber eine rein informelle Austauschplattform, keine Behörde.
Es gibt kein Gesetz, das eindeutig regelt, wann welche Behörde, welche Informationen zu teilen hat und wer welches Verfahren führt. Wir haben im Fall Amri erlebt, zu welchen Konsequenzen diese organisierte Verantwortungslosigkeit führt. Wenn Informationen weitergereicht wurden, hat man entweder nicht richtig reagiert oder sogar anders als besprochen. Nachrichtendienste haben eine bemerkenswert defensive Rolle gespielt. Es braucht deshalb eine echte Reform mit einer gesetzlichen Grundlage.
Das scheint ja schon in Deutschland nur bedingt zu funktionieren. Welche Erfahrungen haben Sie durch Ihre Recherchen für Ihr aktuelles Buch, aber auch Ihre Arbeit im Untersuchungsausschuss gemacht?
Der Untersuchungsausschuss hat an verschiedensten Stellen strukturelle Defizite, wie unter einem Brennglas offengelegt: Verfassungsschutzbehörden, die über Jahre hinweg ein Eigenleben geführt haben. Bei Extremisten eingeschleuste Spitzel wie die „VP-01“ aus NRW, deren Warnungen vor Amri man nicht ernst genommen hat. GTAZ-Absprachen, die nicht eingehalten wurden – mit der Konsequenz, dass Amri überhaupt erst mitbekommen hat, dass er auf dem Radar der Sicherheitsbehörden ist und so gewarnt wurde.
Es gibt viele Beispiele von der RAF, über den NSU und bis zum Fall Amri, bei denen eine effektive Terrorbekämpfung an der Zusammenarbeit der Sicherheitsbehörden gescheitert ist. Deswegen brauchen wir endlich die Reform unserer föderalen Sicherheitsarchitektur, eine effektive parlamentarische Kontrolle und mittelfristig ein europäisches Kriminalamt.