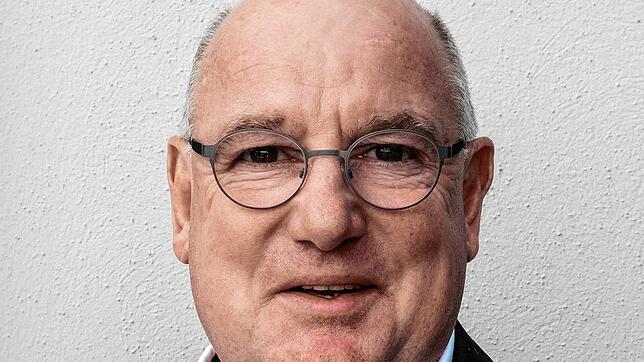Herr Heitlinger, mit gut 30 Litern reinem Saft pro Jahr sind die Deutschen Europameister im Saft-Konsum. Noch! Denn Saft im Supermarkt ist in letzter Zeit extrem teurer geworden. Werden Säfte künftig nur noch was für Reiche sein?
Nein. Die Preise werden nicht dauerhaft so hoch bleiben wie jetzt, aber bis sich der Markt entspannt hat, wird es mindestens ein bis drei Jahre dauern. Richtig ist, dass wir bei wichtigen Sorten wie Orangensaft, Apfelsaft, aber auch bei anderen Produkten, wie Schwarzer Johannisbeere, Kirsche oder Ananas in der letzten Zeit erheblich höhere Preise sehen.

Woran liegt das?
Fast überall wird die Rohware teurer. Hinter dieser Entwicklung stehen saisonale Einflüsse wie ungünstige Wetterbedingungen in wichtigen Anbaugebieten. Spürbar wird das für den Konsumenten aber besonders, weil dieser temporäre Effekt seit einigen Jahren von größeren klimatischen Schwankungen überlagert wird. Wir sehen, dass das Klima verrückt spielt.
Es kommt vermehrt zu Extremwetterereignissen wie Hagel, Frösten, Starkregen oder Dürren, die die Landwirtschaft negativ beeinflussen. Außerdem nimmt der Insektenbefall bestimmter Sorten zu. Die Ernten werden dadurch unsicherer, die Erträge schwanken immer stärker.
Nehmen wir mal den Apfel, die wahrscheinlich deutscheste Frucht überhaupt. Was läuft hier gerade schief?
Der Apfelmarkt ist seit rund einem Jahrzehnt durcheinander. Die seit 2014 bestehenden Sanktionen der EU gegen Russland haben dazu geführt, dass große Erntemengen, die eigentlich für Russland bestimmt waren, dort nicht mehr abgesetzt werden können und nach Europa hineindrücken. Das hat hierzulande jahrelang für die sehr niedrigen Obstpreise gesorgt.
Vergangenes Jahr hat sich die Lage völlig gedreht. In Polen, dem dominierenden Apfel-Anbaugebiet Europas, gab es 2024 späte Fröste, die rund ein Drittel der Ernte vernichtet haben.
Die fehlenden Mengen haben die Apfel- und Apfelsaftpreise in ganz Europa nach oben getrieben. Bei Orangensaft sieht es wieder anders aus. Hier kämpfen die führenden Anbaugebiete in Brasilien und Florida seit einigen Jahren mit einer bakteriellen Krankheit, das sogenannte Citrus-Greening.
Das ist so etwas Ähnliches wie der bei Apfelbäumen bekannte Feuerbrand. Dazu kamen Dürren und Extremwetter in Brasilien, wo 80 Prozent der Orangenbäume der Welt stehen. Als Folge weisen die Saftkonzentratbestände Tiefststände aus. Und das führt zwangsläufig zu hohen Preisen, auch im Supermarkt.

Das hört sich aber so an, als ob es dauerhaft teurer würde?
Die Branche hält schon dagegen. In Brasilien wurden beispielsweise große Orangen-Flächen nachgepflanzt, die in drei Jahren in die Produktion gehen. Das Angebot wird künftig also wieder steigen. Zudem geht aufgrund der hohen Preise im Supermarkt die Nachfrage zurück.
Viele Hersteller haben die Packungsgrößen gesenkt, um den Preis je Gebinde nicht zu stark ansteigen zu lassen. Da ist dann eben statt eines Liters nur 0,7 Liter Saft in der Flasche. Das führt aber dazu, dass weniger Menge verkauft wird. Beide Entwicklungen, tragen dazu bei, dass sich die Preisentwicklung wieder einpendeln wird.
Südbaden verfügt über eine leistungsfähige Keltereibranche. Wie wirkt sich das auf die Hersteller aus?
Alle sind betriebswirtschaftlich unter Druck. Obst zu verarbeiten ist energieintensiv, und der Anstieg der Energietarife in Folge des Ukrainekriegs hat die Produktionskosten erhöht. Da Gas perspektivisch teurer bleiben wird als vor Beginn des Krieges, sehe ich hier auch wenig Entspannung. Dazu kommt, dass die Kraftverhältnisse im Markt gegen die Keltereien und Safterzeuger arbeiten.
Was soll das heißen?
Es ist wie in vielen Bereichen der Landwirtschaft. Wenigen Großabnehmern stehen einige Weiterverarbeiter und sehr viele Erzeuger gegenüber. Konkret: Im Saftgeschäft gibt es Hunderte Keltereien, aber nur vier große Abnehmer. Das sind Edeka mit Penny, Rewe mit Globus, Aldi und Lidl mit Kaufland. Es gibt ein Oligopol bei der Nachfrage.
Für die Safterzeuger wird es daher immer schwieriger, ihre Preise bei den großen Vier durchzusetzen. Das geht vor allem zu Lasten kleinerer Keltereien, die vermehrt aufgeben oder aufgekauft werden. Verstärkt wird der Trend, weil der Lebensmitteleinzelhandel dazu übergeht, Säfte und Mixgetränke selber herzustellen. So wie das bei Edeka und Kaufland etwa bei Wurstwaren schon länger der Fall ist.

Baden-Württemberg hat noch die größten Streuobstbestände Europas. Für die Obsterzeuger gab es zuletzt gute Nachrichten. Die Erzeugerpreise für Mostobst waren 2024 auf einem Rekordniveau. Wird das so bleiben?
Da will ich nicht zu viel Hoffnung machen. Die historischen Höchstpreise für Mostobst im Jahr 2024 waren hauptsächlich den krassen Ernteausfällen in Polen geschuldet. Generell haben wir in Deutschland bei Äpfeln genug Menge im Markt.
Machen Sie uns doch mal Durst auf Saft – welche neuen Trends und Getränke gibt es in der Branche?
Grundsätzlich geht das Angebot der Keltereien heute weit über reine Säfte hinaus. Smoothies haben sich als weiteres Standbein etabliert, genauso wie Michmix- oder Joghurtgetränke mit Fruchtanteil. Dazu kommen immer mehr Frucht-Limonaden. Ein deutsches Phänomen ist übrigens der Rhabarber-Drink. Rhabarber wächst fast nur in Deutschland und daraus erzeugte Limonaden werden auch fast nur hier getrunken.
Gibt es deutsche Eigenheiten im Saftgeschmack?
Die Deutschen stehen auf ein Zusammenwirken von Süße und Säure in Getränken. Rhabarber ist dafür ein gutes Beispiel. Säfte mit dominierender Süße wie Bananen-, Pfirsich- oder Aprikosensaft oder diverse Nektarsorten werden dagegen vor allem in Südeuropa getrunken.
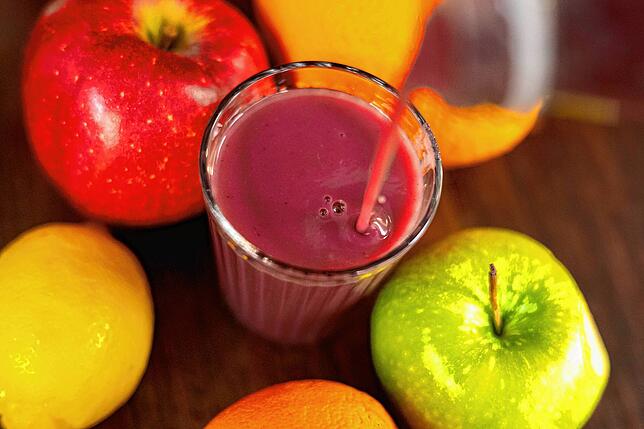
In hochwertigen Apfeldirektsäften sorgt das Streuobst, das gerade am Bodensee noch viel angebaut wird, für die nötige Säure. Welchen Stellenwert hat die klassische Streuobstwiese überhaupt noch für die Saftindustrie?
Die Fruchtsafthersteller nehmen Obst von Streuobstwiesen sehr gerne ab, eben um die von Ihnen beschriebenen Geschmacksnoten in den Saft hineinzubekommen. Das Problem ist hier, dass die Baumbestände, aber auch diejenigen, die sie bewirtschaften, überaltert sind.
Die allermeisten Streuobstbäume wurden in den 1950er und 60er Jahren gepflanzt. Das Lebensalter der Bäume überschreitet selten 70 Jahre. Wenn dann noch Dürresommer wie 2018 dazukommen, gehen die Bestände in die Knie und die Erträge knicken ein.

Muss man Obst von Streuobstwiesen nicht grundsätzlich besser bezahlen?
Generell hat die Fruchtsaftbranche ein hohes Interesse am Erhalt der Bestände. Die Rentabilität des Anbaus können wir aber nur abhängig von den jeweiligen Marktpreisen darstellen. Oder anders: Große Preisaufschläge im Vergleich zu Plantagenware sind nicht drin.
Allerdings haben die hohen Preise für Streuobst im vergangenen Jahr dazu geführt, dass wieder viel mehr Obst aufgesammelt wurde. Dass die Streuobstwiese tot ist, würde ich also nicht sagen.