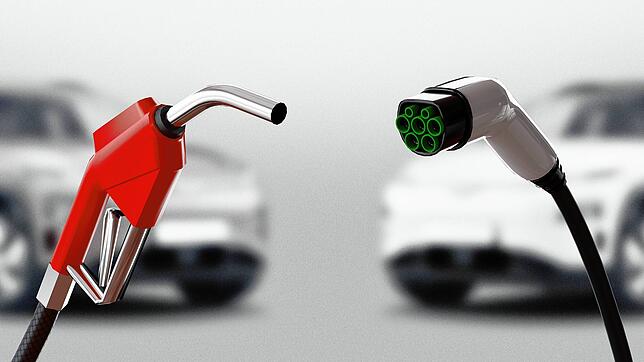Neulich in der Nähe der A20. Vor einem Restaurant steht eine Schnellladesäule für Elektroautos, die von Verbrennern blockiert wird. Der Fahrer des E-Autos hört sich auf dem Parkplatz um: Gibt‘s in der Nähe noch eine andere Stromquelle?
Ein Passant zuckt abschätzig mit den Schultern: „Wenn du ein richtiges Auto hättest, könnte ich die Tankstelle da vorne empfehlen. Aber so…“ Die Szene steht beispielhaft für den Zustand der Elektromobilität in Deutschland. Ein richtiges Auto ist es für die meisten Deutschen offenbar nur dann, wenn unten ein Auspuff dranhängt.
Einbruch mit Aus der staatlichen Förderung
E-Autos genießen hierzulande keinen allzu guten Ruf. Noch immer kursieren Ängste und Vorurteile, die sich in den Verkaufszahlen widerspiegeln. Nach einem kurzzeitigen Boom in den Jahren 2022 und 2023 sind die Zulassungen 2024 drastisch zurückgegangen.
Vergleicht man etwa den November 2024 mit dem November 2023, so wurden laut Kraftfahrtbundesamt 22 Prozent weniger E-Autos zugelassen. Der Einbruch fällt mit dem Aus der staatlichen Förderung zusammen, die die Bundesregierung Ende 2023 abrupt gestrichen hat. In der Autobranche, die sich auf einen schnellen Hochlauf der Elektromobilität eingestellt hatte, sorgt diese Entwicklung für Krisenstimmung.
Nach VW hat auch Ford angekündigt, mehrere Tausend Stellen zu streichen. Als Grund nennt das Unternehmen unter anderem die geringe Nachfrage nach Elektrofahrzeugen. Ist der Boom der Stromer damit vorbei? Erlebt der Verbrennungsmotor nun ein Comeback – ausgerechnet im heißesten Jahr seit Beginn der Wetteraufzeichnungen?
In anderen Ländern läuft es besser
Ganz so einfach ist die Sache nicht. So läuft die Antriebswende in den Niederlanden deutlich besser; dort betrug der Stromer-Anteil bei Neuzulassungen im Jahr 2023 bereits 31 Prozent. Finnland kam auf 33,8 Prozent. An der Spitze liegen Dänemark (36,1 Prozent) und Schweden (38,6 Prozent), wie das Statistische Bundesamt in einem Ranking erläutert. Insgesamt kam die EU auf einen Durchschnittswert von 14,6 Prozent. Bis zum Neuzulassungsverbot für Verbrenner im Jahr 2035 ist also noch viel Luft nach oben.
Dass es auch deutlich schneller gehen kann, sieht man außerhalb der EU. In Großbritannien hat die neue Labour-Regierung das Verbrenner-Aus kürzlich aufs Jahr 2030 vorgezogen. Für Hybridfahrzeuge soll es aber Ausnahmen geben. Sie dürfen Medienberichten zufolge auch bis zum Jahr 2035 noch auf den Markt kommen. Machbar scheint diese Vorgabe durchaus zu sein: Im August 2024 waren auf der Insel bereits knapp 23 Prozent aller neuen Autos elektrisch.
Übertreffen kann diesen Wert nur noch Norwegen. Hier spielen Benzin und Diesel so gut wie keine Rolle mehr. Wie auch – ab 2025 dürfen keine Autos mit Verbrennungsmotor mehr verkauft werden. Der große Aufschrei dagegen ist ausgeblieben, im Gegenteil: „Rekkeviddeangst“, die in Deutschland so verbreitete Reichweitenangst, scheint im hohen Norden kaum ein Thema zu sein. Dabei sind die Strecken oft weit und die Temperaturen eisig.
In China mehr E-Autos als Verbrenner
Der Unterschied zu Deutschland: In Norwegen fährt die Regierung einen glasklaren Kurs in Richtung Elektromobilität. Nicht nur kosten E-Autos deutlich weniger als Verbrenner, weil keine Steuern, keine Maut und oft auch keine Parkplatzgebühren anfallen. Auch ist der Strom in Norwegen nur etwa halb so teuer wie in Deutschland.
Obendrein gilt ein strenges Tempolimit von 100 Kilometern pro Stunde, was zu weniger Verbrauch und damit zu höheren Reichweiten führt. Ein ähnliches Bild zeigt sich in China. 2024 wurden dort erstmals mehr E-Autos als Verbrenner zugelassen. Im August lag der Anteil der Stromer an den Neuzulassungen bereits bei 53,5 Prozent.
Dass die Umstellung so konsequent läuft, hat zum einen mit günstigen Preisen, staatlichen Subventionen und immer besser werdenden heimischen Modellen zu tun. Zum anderen aber auch mit einer drakonischen Politik der Regierung: So werden Kennzeichen für neue Verbrenner in vielen Metropolen nur noch per Losverfahren vergeben. E-Autos hingegen kommen sofort zum Zug.
Die deutsche Autoindustrie, für die China einer der wichtigsten Absatzmärkte ist, kann von dieser Entwicklung bisher kaum profitieren. Im August 2024 befand sich unter den „Top 10“ der meistverkauften E-Autos nur eine einzige nichtchinesische Marke: das US-Unternehmen Tesla.
Vor allem im stark wachsenden Segment der Kleinwagen haben die Deutschen wenig zu bieten. Während Hersteller wie BYD immer neue Modelle für unter 10.000 Euro auf den Markt bringen, konzentriert sich die deutsche Autoindustrie nach wie vor auf große, schwere Modelle – die aber bei Software und Batterietechnik der chinesischen Konkurrenz hinterherhinken.
Autonomes Fahren als Chance
Die deutschen Unternehmen hätten „nicht gedacht, dass die chinesischen Autobauer so schnell so gute und innovative Produkte an den Markt bringen“, analysiert der Automobilexperte Stefan Bratzel auf Tagesschau.de.
Komplett verloren sei der chinesische Markt aber noch nicht: „Die zentralen Einflussfaktoren sind Elektromobilität, aber längerfristig auch autonomes Fahren“, sagt Bratzel. „Wenn es gelingt, in diesen Feldern wieder ganz vorne mitzuspielen, kann Deutschland seine starke Rolle in der Automobilindustrie halten.“ Die nächsten drei bis vier Jahre seien dafür entscheidend.
Auf einem anderen Leitmarkt, in den USA, ist die Lage weniger eindeutig. In den vergangenen Jahren hat die Biden-Regierung massiv in den Bau von Batteriefabriken und Ladestationen investiert. Wer sich ein E-Auto kauft, profitiert von einer Steuergutschrift über 7500 Dollar.
Ähnlich wie in Deutschland könnten die Subventionen aber schon bald enden. Denn Donald Trump hält sie für sinnlos; den Klimawandel leugnet er ohnehin. Unterstützung erhält er dabei ausgerechnet von seinem Vertrauten Elon Musk, dem Chef des E-Auto-Herstellers Tesla. Laut amerikanischen Medien kalkuliert Musk damit, dass die wegfallende Förderung zwar auch Tesla schaden könnte – seiner Konkurrenz aber noch deutlich mehr.
E-Autos sind effizienter
Dabei ergibt die Anschaffung eines E-Autos nicht nur aus ökologischer, sondern auch aus wirtschaftlicher Sicht durchaus Sinn. Das hat mit dem sogenannten Wirkungsgrad zu tun. „Ein Verbrennungsmotor setzt chemische Energie in mechanische Energie um“, erklärt Anna-Lena Menn, Professorin für Ingenieurmathematik an der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg. Dabei gingen im Schnitt 60 Prozent der Leistung als Wärme verloren.
Zwar könne man einen Teil davon zum Heizen des Innenraums nutzen. Trotzdem seien E-Autos deutlich effizienter: „Ein E-Motor setzt elektrische Energie in mechanische Energie um“, so die Expertin. „Dabei werden im Durchschnitt fünf Prozent Verlustleistung generiert, es wird also nahezu alles an Energie übertragen.“
Auch in Deutschland sollte man die Batterieautos trotz der aktuellen Verkaufsdelle deshalb noch nicht abschreiben. Eine Umfrage des Beratungsunternehmens Ernst & Young (EY) zeigt, dass die Kaufbereitschaft aktuell schon wieder steigt. „Es kommen immer bessere Elektroautos auf den Markt, teilweise mit großer Reichweite und kurzen Ladezeiten“, erklärt EY-Analyst Constantin Gall. „Zudem könnten wir einen Preisrutsch auf breiter Front sehen, denn viele Hersteller müssen ihren Absatz von Elektroautos deutlich steigern, um Strafzahlungen wegen zu hoher Flottenemissionen zu vermeiden.“
Keine Frage: Ein Selbstläufer sind die Stromer noch nicht. Aber ganz so düster, wie es manchmal scheint, ist die Lage eben auch nicht. Staaten, die mit Anreizen arbeiten, erleben sogar einen regelrechten Boom. Das große Comeback des Verbrenners? Derzeit ist es nicht in Sicht.