Frau Klodt-Bußmann, seit Jahresanfang sind Sie die neue Hauptgeschäftsführerin der IHK Hochrhein-Bodensee. Was war die größte Überraschung, die Sie bisher erlebt haben?
Klodt-Bußmann: Die IHK ist kein Neuland für mich. Ich kenne das Haus ja durch meine Arbeit als Geschäftsführerin und Leiterin der Abteilung Recht in den Jahren 2008 bis 2010 gut. Außerdem habe ich mich mit meinem Vorgänger, Claudius Marx, bereits in den letzten Wochen des vergangenen Jahres auf meine Tätigkeit vorbereitet. Überraschungen gab es daher noch nicht. Aber die tolle Arbeitsatmosphäre hier und die vielen netten Kolleginnen und Kollegen, das macht mich wirklich glücklich, die Position ausfüllen zu dürfen.

Welche Themen sehen Sie für die kommenden Jahre?
Klodt-Bußmann: Wir stehen vor Zeiten, die so herausfordernd sind, wie schon sehr lange nicht mehr. Sicher ist im Moment nur, dass vieles unsicher ist. Ich sehe meine Aufgabe daher durchaus darin, der Verunsicherung entgegenzuwirken, Zuversicht zu zeigen und den Firmen als Partner zur Seite zu stehen. Wir werden etwa unsere Beratungsaktivitäten bedarfsgerecht ausbauen, bei Themen wie Fachkräftegewinnung, zum Energiebereich, der Lieferkettenproblematik oder bei der immer schwerer zu bewältigenden Bürokratie.
Und rein inhaltlich?
Klodt-Bußmann: Die Zusammenarbeit von Firmen und Hochschulen ist noch deutlich ausbaufähig. Das möchte ich stark in den Fokus nehmen. Dabei geht es darum, den Firmen und Hochschulen Hilfestellungen zu geben, Partner im jeweils passenden Bereich zu finden. So können konkrete Projekte angeschoben werden, die dann wiederum in Arbeitsplätze münden und Wertschöpfung in der Region generieren.
Die Hochschulen früh an die Wirtschaft zu binden hat auch den Charme, junge Fachkräfte und Akademiker direkt in der Region zu halten. Das gelingt uns im Moment noch nicht ausreichend. Sicher werden wir auch das Mantra, des „Höher, Schneller, Mehr“ in der Wirtschaft überdenken müssen und uns die Frage stellen, ob es nicht stärker um qualitatives Wachstum und Nachhaltigkeit gehen sollte. Auf diesem Feld wird auch über die Zukunftsfähigkeit der Firmen entschieden.
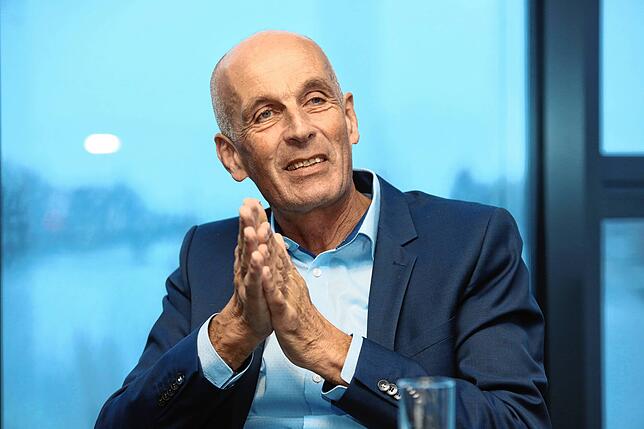
Wie steht es um den Wirtschaftsstandort zwischen Hochrhein, Schwarzwald und Bodensee?
Marx: Die Wirtschaft in der Region ist in einer guten Verfassung. Die generelle Herausforderung ist der hohe Veränderungsdruck. Ich kenne aber keinen gesellschaftlichen Bereich, der besser und effizienter mit Veränderungen umgehen kann als die Unternehmen. Man muss sie aber eben auch machen lassen. Die Firmen brauchen jetzt vor allem verlässliche Rahmenbedingen und Sicherheit für Investitionen. Dann kann die Transformation durchaus gelingen.
Welche Stärken hat der Standort?
Marx: Es ist die Vielzahl der kleinen und mittleren, oft familiengeführten Unternehmen, die die Region stark und auch krisenfest macht. Und es ist die Tatsache, dass Firmen und Belegschaften an einem Strang ziehen und technologisch nach vorne denken.
Klodt-Bußmann: Man sollte auch die Attraktivität der Region als Lebensraum und deren Schönheit nicht verkennen. Gerade jüngere Fachkräfte gehen nach der Ausbildung oft erst einmal in die weite Welt, kommen dann aber wieder zurück. Das bereichert uns und führt nicht zuletzt zu Innovationen vor Ort.
Gleichwohl ist nicht alles Gold, was glänzt. Welche Schwächen gibt es?
Klodt-Bußmann: Wenn wir die Zufriedenheit der Unternehmen abfragen, gibt es einige Bereiche, wo offensichtlich etwas im Argen liegt. Das sind neben den Kosten, etwa für Energie, und dem Fachkräftemangel vor allem Preise und Verfügbarkeit von Wohn- und Geschäftsimmobilien. Kurz zusammengefasst brauchen die Firmen Mitarbeiter, aber die müssen sich das Wohnen hier auch leisten können.
Marx: Die Regelungsdichte hat in Deutschland ein Ausmaß angenommen, das zu einer Gefahr für den Standort wird. Um noch mehr Sicherheit für den Einzelnen zu schaffen, schränken wir die Freiheit für alle immer umfassender ein. Da haben wir in Deutschland das gesunde Maß verloren. Und das kostet uns Chancen, gesellschaftlich wie auch wirtschaftlich.

Braucht der Mittelstand mehr Mut, Unsicherheiten in Kauf zu nehmen, also mehr Start-Up-Denke?
Marx: Uns fehlt manchmal der Mut, mit Schrot zu schießen, will sagen, ohne schon vorab zu wissen, ob alle Kugeln ins Schwarze treffen. Genau so gehen hochinnovative Firmen aber vor. Ich denke, auch der Mittelstand kann mit diesem Prinzip reüssieren.
Klodt-Bußmann: Trial-and-Error ist ein Konzept, das zu Unrecht negativ behaftet ist, weil es auch das Scheitern beinhaltet. Scheitern ist aber kein Makel, sondern heutzutage in vielen Geschäftsfelder eine Voraussetzung, um überhaupt den innovativen Weg zu finden und Erfolg haben zu können.
Mit Blick auf die Infrastruktur ist Südbaden abgehängt. Die durchgängige Bahnverbindung nach Stuttgart ist Geschichte, der Aufbau eines Wasserstoffkernnetzes geht an der Region vorbei. Wie dramatisch ist das?
Marx: Das ist ohne Zweifel ein wunder Punkt. Wenn man die Deutschlandkarte betrachtet, ist die links unten immer weiß, egal ob es um Autobahnen, Elektrifizierung der Schienenwege, Mobilfunk oder Wasserstoff geht. Die Welt wird nicht so digital werden, dass man keine Straßen oder Schienen mehr bräuchte. Maschinen und Fahrzeugteile können sie nun mal nicht per E-Mail verschicken. Wirtschaft, Politik, aber auch wir als Kammern, müssen uns hier mehr Gehör verschaffen. Wir müssen trommeln und extrem kämpfen, um nicht ins Abseits zu geraten.
Die Schweiz wird als Arbeitsmarkt für hiesige Fachkräfte immer attraktiver. Wie kann man gegenhalten?
Marx: Was die Lohn- und Arbeitsbedingungen betrifft, duellieren sich Deutschland und die Schweiz nicht mit gleich langen Spießen. Deswegen wird es immer einen Brain-Drain Richtung Schweiz geben. Damit müssen wir leben. Ein offener Arbeitsmarkt kann uns aber auch zugutekommen. Genau wie der Schweiz muss es eben auch uns gelingen, Fachkräfte von anderswo anzuziehen. Der Saldo aus Zu- und Abwanderung zählt.

Mehr Zuwanderung also?
Marx: Die Schweizer Bevölkerung ist maßgeblich durch Zuwanderung im neuen Jahrtausend von rund sieben Millionen auf über neun Millionen Einwohner gewachsen, Tendenz steigend. Und da kamen bei weitem nicht nur Deutsche und Franzosen ins Land, sondern auch viele andere Nationalitäten. Da hat es innenpolitisch auch geruckelt, aber die Schweiz hat die Integration geschafft. Genauso muss es uns auch gelingen, wenn wir dem Arbeitskräftemangel Herr werden und unser wirtschaftliches Potenzial ausschöpfen wollen.
Was können wir von der Schweiz lernen?
Marx: Wir beobachten in der Schweiz kürzere Wege vom Denken zum Handeln und vom Planen zum Tun und eine Art von Pragmatismus, die uns vielleicht manchmal abhandengekommen ist.
Klodt-Bußmann: Die Schweizer Demokratie zeichnet das Instrument der Volksentscheide aus. Diese werden in der Bevölkerung als verbindlich und abschließend akzeptiert. Eine solche abschließende Akzeptanz fehlt uns zusehends bei Entscheidungen unserer demokratisch gewählten Volksvertreter. Und das kostet uns oft wertvolle Zeit in der Umsetzung. Stattdessen „verzetteln“ wir uns teilweise in immer wiederkehrenden Debatten.
Marx: Wir neigen zur Überdramatisierung. Wenn irgendwo ein paar Bauern demonstrieren, muss man nicht den gesellschaftlichen Umsturz an die Wand malen. Ich glaube, dass unsere Gesellschaft wesentlich stabiler ist, als sie oft dargestellt wird. Und das gilt gleichermaßen für die Wirtschaft.

Schweizer Einkaufstouristen tragen jedes Jahr Milliardenbeträge ins benachbarte Ausland. Wie sind die Perspektiven für die Region?
Marx: Die Treiber des Einkaufstourismus sind ein Bündel aus sehr viel höherem Schweizer Lohnniveau und daraus resultierender Kaufkraft, dem ebenfalls höheren Preisniveau im Einzelhandel in der Schweiz, dem Wechselkurs zum Franken und nicht zuletzt der Umsatzsteuerrückerstattung. Auch wenn einzelne dieser Faktoren an Zugkraft verlieren sollten, wird der Gesamtanreiz, in Deutschland einzukaufen, hoch bleiben. Ich rechne daher weiter mit hohen Umsätzen durch Schweizer bei uns.
Klodt-Bußmann: Die Herausforderung für den hiesigen Einzelhandel wird sein, sich Trends wie der Digitalisierung oder konkret dem Onlinehandel erfolgreich zu stellen und neue Konzepte für die Innenstädte zu entwickeln. Wir müssen sicherstellen, dass diese auch künftig als lebenswerter Raum wahrgenommen werden, in die man gerne kommt und dort auch verweilt – sei es zum Flanieren oder zum Konsumieren.
Ist Gelassenheit das Wort der Stunde?
Klodt-Bußmann: Zumindest Zuversicht und Vertrauen in die eigenen Stärken. Katastrophenszenarien zu viel Raum zu geben, bringt niemandem etwas. Wir müssen die Dinge anpacken und zuversichtlich nach vorne schauen. Und wir dürfen nicht immer der Vergangenheit nachtrauern. Die Welt ändert sich, und nicht immer wird alles schlechter.








